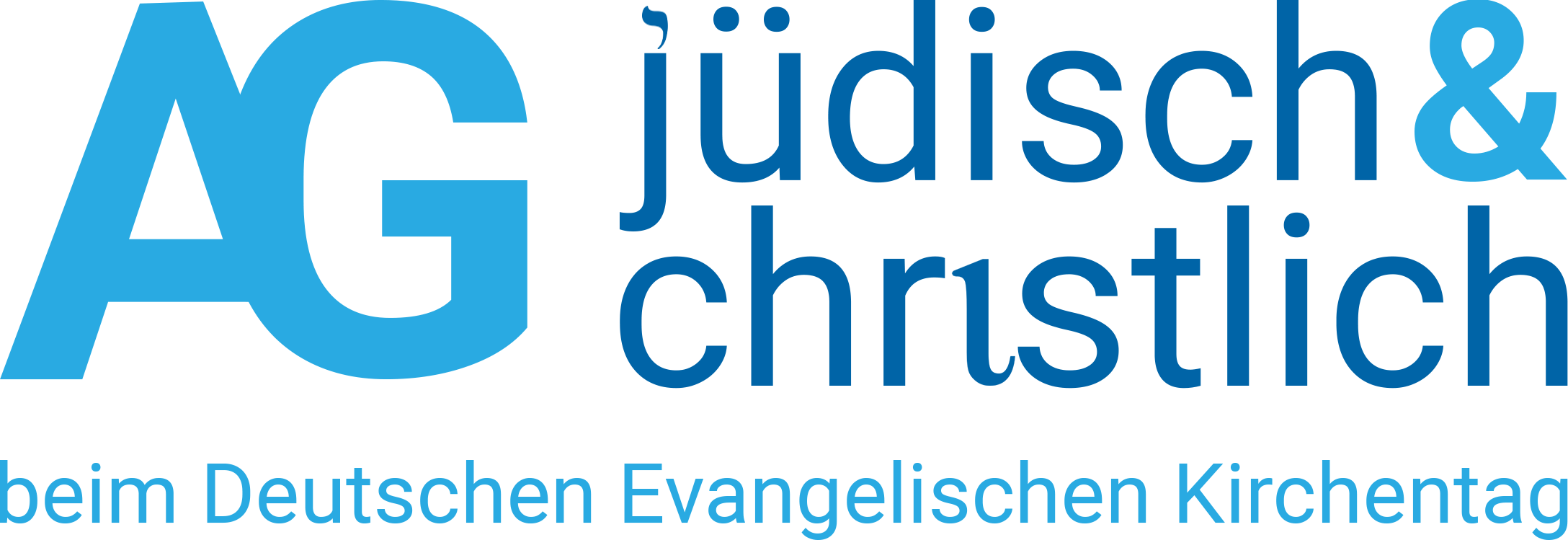Von einer, die auszog zu lernen
Ein Zwischenruf
Aline Seel

Dies ist ein Zwischenruf aus Betroffenenperspektive. Ich schreibe ihn als Vikarin, die nun fast am Ende ihrer Ausbildung angelangt auf ihre bisherige Lernerfahrung/prozesse der Bildungsbiographie schaut. Mein Studium habe ich begonnen, weil ich wissen wollte, wie das Christentum als Liebesreligion zu so einer Gewalt fähig sein konnte, wie sie sich in unvergleichbarem Ausmaß in der Ermordung von sechs Millionen Juden zur Zeit des Nationalsozialismus gezeigt hatte. Mit den Jahren wurde mir mehr und mehr klar, dass die Shoah, wenn auch den Höhepunkt, so doch keinen Einzelfall in der brutalen antijüdischen Gewaltgeschichte meiner Kirche gebildet hatte. Judenfeindschaft war historisch eine der dominanten theologischen Grundlinien, die dabei funktional der Selbstsicherung des christlichen Glaubens diente.
Durch Familienbande aneinander gebunden
Zugleich kenne ich kaum eine intimere Beziehung von Religionen als die zwischen Juden und Christen. Wir teilen Elemente von Gebeten, Melodien in Synagoge und Kirche, die Hoffnung auf eine Welt, die von der Gerechtigkeit Gottes lebt. In den letzten Jahren wurde gerade durch die judaistische Forschung deutlich, dass Christentum und rabbinisches Judentum ungefähr gleichzeitig und in gegenseitiger Beeinflussung entstanden sind. Das Mutter-Tochter-Paradigma wurde so von einer Art Geschwister-Modell abgelöst. Durch Familienbande aneinander gebunden sind wir in jedem Fall.
Ich kenne kaum eine Beziehung, die spannungsreicher wäre als die zwischen Juden und Christen. Doch wer erwartet, dass es innerhalb der universitären Ausbildung eine Grundlinie wäre, sich dieser Spannung anzunehmen, geht fehlt. Je bewusster mir die Intensität und Komplexität jüdisch-christlicher Beziehungen wurde, desto enttäuschter war ich, dass sie in den meisten der von mir besuchten Lehrveranstaltungen keine Rolle spielte.
Jüdisch-christliche Beziehungen – im Studium eine Fehlanzeige
Der Priester und Dichter Huub Oosterhuis hat einmal gesagt, dass die Tatsache, dass Jesus ein Jude ist, für eine Reihe christlicher Theologen die größte Entdeckung des 20. Jh. war. Er fügte hinzu: »Die christlichen Kirchen werden einen Großteil des 21. Jahrhunderts benötigen, um diese Entdeckung in ihrer Glaubenssprache zu verarbeiten«.1 Dieser Wunsch war ein im besten Sinn des Wortes frommer Wunsch, der zugleich mit Blick auf die Wirklichkeit unserer Kirche fast illusionär wirkt. Auch wenn in den Grundordnungen fast aller Landeskirchen2 die bleibende Erwählung Israels und die untrennbare Verbundenheit mit dem jüdischen Volk fest verankert ist, so ist doch in Universitäten und Gemeinden oftmals kaum etwas angekommen von dem, was in den letzten Jahrzehnten an vielen Orten jüdisch-christlichen Gesprächs errungen worden ist. Wie kann also ein bisher von wenigen Fachleuten und Engagierten getragenes Gespräch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Wird es sich doch, so der Praktische Theologe Alexander Deeg, primär »in der kirchlichen Praxis, im Reden und Handeln der Christinnen und Christen erweisen, ob von einer Erneuerung der Kirche in Israels Gegenwart gesprochen werden kann oder nicht.«3
Eine akademische Bestandsaufnahme
Mit dem Vorstand der AG »Juden und Christen« beim Deutschen Evang. Kirchentag (DEKT) machten wir uns deshalb gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Prakt. Theologie und Bildungsforschung an der Georg-August-Universität Göttingen auf, ein über »Privatempirie« hinausreichendes Bild der Lage der Ausbildung von TheologInnen und ReligionspädagogInnen zu gewinnen. Es entstand das Projekt zur Analyse der Curricula des Studiums der Evang. Theologie für Pfarramt und Lehramt in Bezug auf jüdische und/oder jüdisch-christliche Lehrinhalte, welches von verschiedenen Landeskirchen unterstützt und finanziert wurde.
In einem ersten Schritt ging es hier um eine Bestandsaufnahme, ob, und wenn ja, in welchem Umfang und mit welchen Inhalten sowohl »Judentum« als auch das »jüdisch-christliche Verhältnis« in den das Studium der Evang. Theologie strukturierenden Curricula bzw. Modulkatalogen thematisiert werden. In einem zweiten Schritt wurden auf Grundlage der Bestandsaufnahme sowohl Vorschläge gesammelt, als auch Thesen erarbeitet, wie jüdische und/oder jüdisch-christliche Lehrinhalte im Interesse einer Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses zielführender in den Curricula bzw. Modulkatalogen verankert werden könnten. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und die Vorschläge wurden im Dezember 2016 auf einem Fachtag in Zusammenarbeit mit der Evang. Akademie zu Berlin präsentiert, diskutiert, weiterentwickelt und weitergetragen. Die im Rahmen von Projekt und Fachtag entstandenen Publikationen sind in einer EPD-Dokumentation veröffentlich und online zugänglich auf der Homepage der AG.
»Reform der Reformation«
Dem gesamten Projekt haben wir den ganz unbescheidenen Titel »Reform der Reformation« gegeben. Gerade die Erinnerung an die Reformation im Jahr 2017 sollte Anlass sein, die Frage der Ausbildung grundsätzlich zu bedenken. Es gibt inzwischen ein verstärktes Bewusstsein dafür, dass die antijüdischen Implikationen der Theologie Martin Luthers nicht nur das Judentum als lebendiges Gegenüber missachten sondern damit auch das Evangelium. Der Beschluss der EKD-Synode zum Thema »Martin Luther und die Juden – Notwendige Erinnerung zum Reformationsjubiläum« (2015)4beinhaltet folgende Selbstverpflichtung: »Wir stellen uns in Theologie und Kirche der Herausforderung, zentrale theologische Lehren der Reformation neu zu bedenken und dabei nicht in abwertende Stereotype zu Lasten des Judentums zu verfallen.« Aus dem EKD-Beschluss und den Grundordnungen der Landeskirchen müssten sich demnach Schritte zur Veränderung ergeben.
Die Frage, an welchen Orten und auf welche Weise eine Implementierung genannter Inhalte erfolgen kann und soll, wird momentan auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Sicher sollte es in einer Umkehrbewegung nicht darum gehen, das Antijüdische durch ein gesetztes normatives Ergebnis jüdisch-christlichen Gesprächs zu ersetzen. Das jüdisch-christliche Gespräch ist ein Gespräch, das wiederum aus vielen verschiedenen Gesprächen besteht. Sie wurden und werden von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten geführt, auch Institutionen und Gemeinschaften wirken dabei mit. Auf Grund dieses prozessualen Charakters ist dieses Gespräch nie abgeschlossen noch erledigt. Zu produktiven Lernprozessen gehört, dass sie Lernprozesse bleiben. Das Erreichte muss gewürdigt werden, ohne dabei selbstgefällig zu werden. In dem Wort »Lernerfahrungen« steckt einer der wichtigsten Momente des Dialogs selber – Menschen und ihre Glaubenssätze verändern sich, wenn sie von und miteinander lernen und so bleibt das Lernen selber ein unabgeschlossener Prozess.
Dass durch das Lernen vom Judentum eine Umkehr und ein tieferes Verständnis christlichen Glaubens möglich ist, war und ist befreiende Erkenntnis für viele im Dialog Engagierte. Ich musste für solche Lernprozesse in der Regel aus der Universität ausziehen. Eine Reform der Reformation hieße, dass in künftigen Generationen nicht mehr Einzelne zum Lernen ausziehen müssen, sondern dass dieses Lernen als Gemeinschaftsaufgabe in die universitäre und kirchliche Ausbildung einzieht.
Zuerst erschienen in: Deutsches Pfarrerblatt – Heft: 8/2017
Fußnoten
- Huub Oosterhuis, Ich steh vor dir. Meditationen, Gebete und Lieder. Basel/Wien 2004, 81.
- Vgl. etwa EKBO, Art. 12.
- Alexander Deeg, Predigt und Derascha. Homiletische Textlektüre im Dialog mit dem Judentum. Göttingen 2006, 32.
- http://archiv.ekd.de/synode2015_bremen/beschluesse/s15_04_iv_7_kundgebung_martin_luther_und_die_juden.html