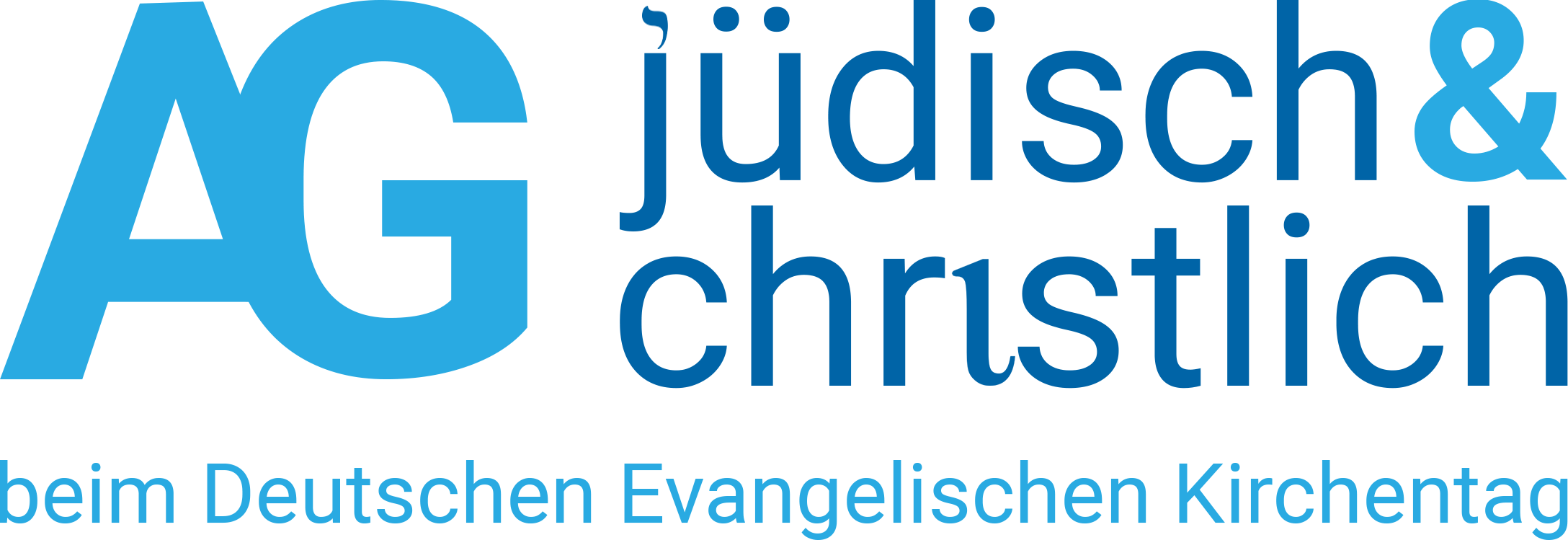Gemeinsam in Verschiedenheit
Eine politisch-theologische Perspektive auf das christlich-jüdische Gespräch
Martin Stöhr

Nach dem Stand der christlich-jüdischen Gespräche zu fragen heißt an die Ausgangspunkte zu erinnern, die politisch und theologisch zu bedenken sind: den Versuch, das europäische Judentum zu vernichten, den Beitrag des theologischen Antijudaismus zum Judenhass sowie – positiv – die Existenz des Staates Israel.
Zwischen Vergessen und Aufklärung
In Berlin 1961 arbeiten Juden mit Christen erstmals gleichberechtigt in einem interreligiösen, öffentlichen Diskurs auf dem Kirchentag. Er ist asymmetrisch. Die Minderheit der überlebenden Juden reist aus ihrem Exil an und kommt in eine Mehrheitsgesellschaft, in der lieber vergessen als aufgeklärt wird. Es gab wenige Widerständige.
Was trieb sie an? Es wird wissenschaftlich und mit Zeitzeugen gefragt, wie und warum die Kirchen mit allen gesellschaftlichen Organisationen sowie die meisten Christen und Nichtchristen abseits standen, als die jüdischen Gemeinden und ihre Gotteshäuser zerstört wurden. Die demokratische Verfassung der Weimarer Republik mit Menschenrechten, Gerechtigkeit und Freiheit fand wenig Verteidiger, während Antisemitismus und Nationalismus mit Befürwortern und sie verstärkenden Gleichgültigen rechnen konnten.
Nie wieder …
Anfangs stellte sich pädagogisch und politisch die Frage, ob und was aus den Verbrechen der Vergangenheit zu lernen ist. Der Satz „Nie wieder“ sagt heutigen Generationen nach Shoah und Krieg wenig bis nichts. Politisches und gesellschaftliches Engagement, Einüben von Kritik und Selbstkritik gehören dazu, gerade wenn Antisemitismus, Islamophobie und Antiziganismus wachsen. Es wird gefragt, wie ethische Verantwortung in und von großen und kleinen Organisationen wahrzunehmen ist. Und das in einer Welt, die immer stärker vernetzt ist, deren Wissen sich rasant vermehrt, während das Gewissen Einzelner und von Institutionen sowie eine Ethik zu Gerechtigkeit und Verantwortung, Freiheit und Frieden leicht ins Hintertreffen geraten.
Aufarbeitung notwendig
Das allzu leicht gebrauchte Wort vom „gemeinsamen jüdisch-christlichen Erbe“ beschwört etwas, was es hierzulande kaum gab. Und es darf nicht als Bollwerk gegen Islam und Säkularismus in Stellung gebracht werden. Zu den Schwierigkeiten des heutigen Dialogs gehört, dass unsere Gesellschaft und viele ihrer Institutionen gespalten sind. Blockiert die Bildung von einem „Pro-Israel-Lager“ und einem „Pro-Palästina-Lager“ die notwendige öffentliche Debatte? Stimmt die Meinung, in der historischen, theologischen und pädagogischen Arbeit der letzten Jahrzehnte seien die Fehlentwicklungen in den deutsch-jüdischen und christlich-jüdischen Beziehungen durch Medien, Fakultäten und gesellschaftliche Gruppen aufgearbeitet? Jetzt gehe es vorrangig um den Islam!
Noch immer ist eine unhaltbare Geschichtsideologie zur Religions- und Kirchengeschichte aufzuarbeiten. Nach ihr hat die Kirche als das „neue“ oder „wahre“ Israel das jüdische Volk als Gottes Zeuge abgelöst, weil das jüdische Volk Jesus als Messias abgelehnt habe. Deshalb sei es enterbt und die „Tochter“ Kirche an die Stelle der „Mutter“ Israel getreten. Beide jedoch sind Geschwister auf Augenhöhe, weil sie auf dem Grund der gemeinsamen, wenn auch unterschiedlich gelesenen Hebräischen Bibel leben.
Jesus bleibt Jude
Der Jude Jesus hatte wie die Urchristenheit keine andere Heilige Schrift. Er ist mit seinem Sterben und Leben und mit seiner Botschaft keineswegs im Gegensatz zum Judentum zu definieren. Er verließ seine jüdische Gemeinde nie, rang in ihr und mit ihr um das rechte Verständnis der Bibel. Das „Ich aber sage euch …“ in der Bergpredigt ist keine Antithese zum Alten Testament, sondern seine Auslegung. Wird das vergessen, werden die jüdische Bibel, also auch der größte Teil der christlichen Bibel, wie das Judentum zu bloßen Vorgeschichten des Christusgeschehens. Dabei steht für Israel wie für die Kirche die Vollendung des Gottesreiches, für die Christen die Wiederkehr des Christus aus. Der christliche Glaube an Jesus als den Messias unterscheidet Juden und Christen, schafft aber weder eine christliche Überlegenheit noch ein jüdisches Defizit.
Messianisch hoffen beide. Der Ruf zur Umkehr im Alltag durch Johannes den Täufer und durch Jesus angesichts des nahen Gottesreiches ist ein biblisch-prophetischer Ruf „heute, so ihr seine Stimme hört“ (Ps 95,7; Hebr 3,7.15). Eine Kernfrage muss beantwortet werden: Wie können Christen sich zu Jesus, dem Messias, dem Christus mit guten biblischen Gründen bekennen, ohne den jüdischen Glauben als defizitär abzuwerten?
Vielfalt christlicher Konfessionen
Am Anfang der christlichen Lehrentwicklung stehen viele Christologien, nicht eine. Die Vielfalt der christlichen Konfessionen verdankt sich nicht den Abspaltungen von einem einst einheitlichen Urbekenntnis als vielmehr den unterschiedlichen Akzentsetzungen der neutestamentlichen Autoren sowie den Einflüssen unterschiedlicher sozialer, kultureller oder staatlicher Kontexte und Epochen. Paulus schreibt zwei Generationen vor dem Zeitdiagnostiker und Apokalyptiker Johannes oder dem Ethiker Jakobus. Die Evangelien sind nicht jeweils aus einem Guss geschrieben, sondern Materialsammlungen, die auf „Augenzeugen und Diener des Wortes“ (Luk 1,4) zurückgehen. Werden die Worte der Bibel als „Dogmen“ fixiert, sind sie gleichsam „zerreißfeste Weltanschauungen“ (Robert Musil) oder Erlasse irgendeiner „Hauptverwaltung ewiger Wahrheiten“ (Robert Havemann), leblos, aber lebensgefährlich.
Im lebendigen Gespräch bleiben
Die Texte der Bibel stammen aus tausend Jahren, entfalten sich, enthalten Widersprüche, setzen in neuen Situationen und anderen Zeiten neue Schwerpunkte. Kirche und Israel sind in einem lebendigen Gespräch mit und über Gott und die Welt unterwegs. Wie – darüber geht in der rabbinischen Literatur wie bei den Kirchenvätern eine lebendige Diskussion. Wege zu Gottes Wahrheit verfügen nicht über sie, aber sie ist als „Stückwerk“ (so Paulus 1 Kor 13) zu erkennen. Erst ein Staatskirchentum nach Konstantin verlangt im Imperium Romanum eine einheitliche Lehre.
Positive Wende
Am 10.9.2000 spricht in der „New York Times“ ein Aufruf vieler jüdischer Wissenschaftler und Rabbiner von einer dramatischen und positiven Wende in den christlich-jüdischen Beziehungen – nach „2000 Jahren, in denen das Judentum als Vorläufer-Religion des Christentums“ nur wahrgenommen wurde. Vielleicht beschreibt das einige Schritte auf dem Weg, den der russische Religionsphilosoph Wladimir Solovjov um 1900 in seiner „Erzählung vom Antichrist“ für das Ende der Tage visionär sieht (nach Micha 4,1-5): Die Völker der Welt ziehen gemeinsam, aber in Konfessionen unterschieden nach Jerusalem, dem Zentrum des jüdischen Volkes. Sie werden jeweils angeführt von einem Patriarchen Johannes, einem Papst Petrus und einem Professor Pauli. Solovjov sieht orthodoxe Theologie und Kirche repräsentiert durch „Johannes“, das heißt die neutestamentlichen Schriften, die seinen Namen tragen. Petrus, als erster Inhaber des römischen Bischofssitzes, vertritt die römischen Katholiken. Für die Protestanten steht der Apostel Paulus, dessen Theologie die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte weitgehend prägen.
Dieser Beitrag erschien zuerst im Magazin Der Kirchentag (1) 2018, 20–21.