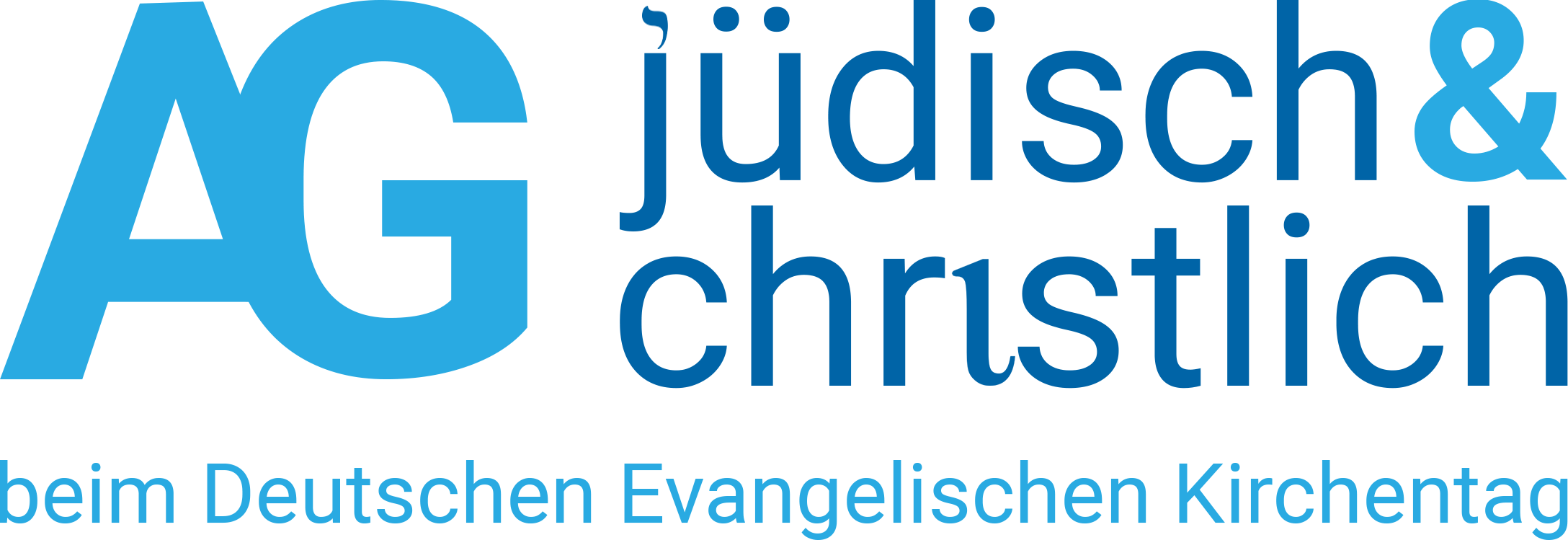Pädagogische Reaktionen auf Antisemitismus
Micha Brumlik
1. Dass Auschwitz sich nie wiederhole …
Es war Theodor W. Adorno, der jenen Intentionen, die einer Erziehung und Bildung im Hinblick auf den Nationalsozialismus bis heute ihre bisher unübertroffene Artikulation gegeben hat. Ziel aller Pädagogik, so Adorno, müsse es sein, dass Auschwitz sich nicht wiederhole und: schon alleine die Forderung nach einer Begründung dieses Postulats prolongiere das Unheil, dem es zu entgegnen gälte (vgl. Meseth/Adorno 2000: 30 ff.). Dabei war dieses Postulat, aus Erfahrung begründet, bereits oberste Räson des bundesrepublikanischen Verfassungsstaates. Es geht um die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, genauer gesagt dessen Artikel 1, in der die „Würde des Menschen“ als Kriterium aller Gesetzgebung und aller staatlichen Machtausübung festlegt, seinen gültigen Ausdruck gefunden hat. Dieses Prinzip hat bedeutende historische Wurzeln. Es war die kosmopolitische Philosophie der deutschen Aufklärung, zumal Immanuel Kants, die die nach dem Nationalsozialismus geschaffene deutsche Verfassung, das Grundgesetz wesentlich geprägt hat. Als oberstes Prinzip der Tugendlehre weist Kant in der Metaphysik der Sitten Folgendes aus:
„Nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich selbst als andern Zweck und es ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brauchen befugt ist, sondern den Menschen überhaupt sich zum Zwecke zu machen, ist des Menschen Pflicht.“ (Kant 1968: 526)
Einen Menschen als Zweck seiner selbst zu betrachten, bedeutet, ihn in mindestens drei wesentlichen Dimensionen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, zu tolerieren, sondern auch anzuerkennen, d.h. nicht nur hinzunehmen, sondern zu bejahen in der Dimension körperlicher Integrität, personaler Identität und soziokultureller Zugehörigkeit. Dieser Anerkennung korrespondiert ein Demütigungsverbot. Das Demütigungsverbot aber bezieht sich auf die „Würde“ eines Menschen. Diese „Würde“ eines Menschen ist der äußere Ausdruck seiner Selbstachtung, also jener Haltung, „die Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen, und die Würde ist die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich achtet.“ (Margalit 1996: 72) Diese Selbstachtung wird verletzt, wenn Menschen die Kontrolle über ihren Körper genommen wird, sie als die Person, die sie sprechend und handelnd sind, nicht beachtet oder ernst genommen beziehungsweise wenn die Gruppen oder sozialen Kontexte, denen sie entstammen, herabgesetzt oder verächtlich gemacht werden. Die Verletzung dieser Grenzen drückt sich bei den Opfern von Demütigungshandlungen als Scham aus (vgl. Brumlik 2002a: 65). Es gibt eine absolute Scham, in der deutlich wird, dass nicht nur die Würde des Menschen, sondern zugleich seine Menschheit verletzt worden ist. In dem kristallklarem und nüchternem Bericht des italienisch-jüdischen Chemikers Primo Levi über seine Lagerhaft in Auschwitz wird den Erfahrungen absoluter Entwürdigung Rechnung getragen; der Ausdruck von der „Würde des Menschen“ beziehungsweise der „Würde des Menschen“ gewinnt vor der Kulisse von Auschwitz eine gebieterische und einleuchtende Kraft: „Mensch ist,“ so notiert Levi für den 26. Januar 1944, einen Tag vor der Befreiung des Lagers, „wer tötet, wer Unrecht zufügt oder erleidet; kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann, der ist, wenngleich ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als […] der grausamste Sadist.“ (Levi 1986: 164)
Unter diesen Bedingungen schwindet dann auch die natürliche Neigung zur Nächstenliebe. Levi fährt fort: „Ein Teil unseres Seins wohnt in den Seelen der uns Nahestehenden: darum ist das Erleben dessen ein nicht-menschliches, der Tage gekannt hat, da der Mensch in den Augen des Menschen ein Ding gewesen ist.“ (ebd.)
Mit dem Begriff der „Würde des Menschen“ wird lediglich ein Minimum angesprochen, der kleinste gemeinsame Nenner nicht von Gesellschaften, sondern von jenen politischen Gemeinwesen, von Staaten, die wir als „zivilisiert“, nicht unbedingt als „gerecht“ bezeichnen. Bei alledem ist die Einsicht in die Würde des Menschen jedoch nicht auf intellektuelle Operationen beschränkt, sie ist mehr oder gar anderes: Das Verständnis für die Würde des Menschen wurzelt in einem moralischen Gefühl (vgl. Brumlik 2002a: 65). Dieses Gefühl ist moralisch, weil es Beurteilungsmaßstäbe für Handlungen und Unterlassungen bereitstellt, es ist indes ein Gefühl, weil es sich bei ihm nicht um einen kalkulatorischen Maßstab, sondern um eine umfassende, spontan wirkende, welterschließende Einstellung handelt. Wer erst lange darüber nachdenken muss, ob einem oder mehreren Menschen die proklamierte Würde auch tatsächlich zukommt, hat noch nicht verstanden, was „Menschenwürde“ ist. Es handelt sich beim Verständnis der Menschenwürde also um ein moralisches Gefühl mit universalistischem Anspruch, das unter höchst voraussetzungsreichen Bedingungen steht.
- Die Anerkennung der Integrität anderer ist an die Erfahrung eigener Integrität und Anerkennung, die sich in Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung artikuliert, gebunden.
- Niemand kann Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung entfalten, der nicht seinerseits in allen wesentlichen Bezügen toleriert, akzeptiert und respektiert worden ist.
- Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung sind die logischen und entwicklungsbezogenen Voraussetzungen dafür, Einfühlung, Empathie in andere entfalten zu können (vgl. Honneth 1992; vgl. Brumlik 2002b).
Es sind diese Erfahrungen, die in der politischen Bildung in Deutschland die industrielle Massenvernichtung der europäischen Juden bisher als gleichsam negative Folie, als unüberbietbares Extrembeispiel für die Verletzung der Würde des Menschen dienten, als ein Extrembeispiel, an dem drastisch sichtbar und fühlbar wird, wohin blindes Ressentiment, Rassismus, politischer Partikularismus und eine entfesselte, von aller ethischen Bindung gelöste Sozialtechnik führen kann.
2. Pädagogische Schwierigkeiten
Freilich hatte Adorno, aber das ist an dieser Stelle nicht zu vertiefen, übersehen, dass eine Erziehung nach Auschwitz, stets auch eine Erziehung über Auschwitz sein muss und es ist ein erhebliches didaktisches, fachdidaktisches Problem, wie man diesen in der Tat furchtbaren und widrigen Gegenstand Kindern oder Heranwachsenden so vermitteln kann, dass er nachhaltige und sachangemessene moralische Haltungen ermöglicht. Als zentrales Problem einer pädagogischen Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus kann in Deutschland, in Europa nach dem nationalsozialistischen Massenmord an sechs Millionen europäischer Juden der Umstand gelten, dass jede antisemitische Äußerung bereits mit der Bereitschaft, Massenmorde zu begehen gleichzusetzen und daher Personen, die sich antisemitisch äußern, von vorneherein auszugrenzen und ihnen eine aufklärende Konfrontation vorzuenthalten.
Die Frage nach der Möglichkeit, Antisemitismus pädagogisch zu begegnen und sein Auftreten dort, wo vor allem bei Jugendlichen beobachtbar, weniger wahrscheinlich zu machen oder gar zum Verschwinden zu bringen, setzt daher eine genaue Diagnose dessen, was Antisemitismus ist, ebenso voraus wie eine nähere Bestimmung dessen, was hier „Pädagogik“ heißen soll. Unter „Pädagogik“ seien dabei alle Praktiken verstanden, die jenseits der Familie, also in Vorschule, Schule und öffentlich getragener Jugend- und Bildungsarbeit mit diesem Ziel betrieben werden. Die Frage nach einer innerfamiliären Auseinandersetzung wird hier bewusst nicht thematisiert, da es hier entweder die Eltern selbst sind, die entsprechende Haltungen hervorbringen oder fördern oder aber heftige weltanschauliche Konflikte zwischen Eltern und Kindern herrschen, die ohne eine eingehendere Analyse der familiären Dynamik nicht zu lösen sind. Darum soll im Folgenden zunächst erläutert werden, was „Antisemitismus“ ist, sodann skizziert, in welchen Formen er derzeit im Forum öffentlicher Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Nationalsozialismus vermittelt wird, um schließlich die Chancen und Risiken pädagogischer Interventionen zu wägen.
3. Was ist also Antisemitismus?
Unter „Antisemitismus“ werden vielfältige Formen der Judenfeindschaft verstanden, die sich in unbegründeten, spontanen Ressentiments, unbegründeten und der Sache nach falschen Vorurteilen sowie in individuellen, gruppenbezogenen oder auch institutionellen Verhaltensweisen über verbale Hetze und politische Diskriminierung bis zum Massenmord äußern kann und auch geäußert hat. Der mehr als 2.000 Jahre alte, in der Geschichte Europas immer wieder aufflammende, sich in unterschiedlicher Intensität äußernde Judenhass wechselte seine Form mit der Gesellschaft, in der er auftritt, auch mit ihrem Alltag. Im europäischen Bereich spielt dabei die Unterscheidung zwischen einem kirchlich gebundenen Antijudaismus und einem modernen Rassenantisemitismus die entscheidende Rolle. So sehr der moderne Rassenantisemitismus den kirchlichen Antijudaismus voraussetzt, so wenig sind doch beide miteinander identisch (vgl. Zumbini 2003).
Im Antijudaismus gelten die Juden als Gottesmörder, Kinder des Satans und Heilsverhinderer – Eigenschaften, die sie durch eine Bekehrung zum Glauben der Kirche aufgeben können. Im modernen Rassenantisemitismus hingegen, der sich seit dem frühe 19. Jahrhundert auf den Spuren des Antijudaismus entwickelte, spielt das religiöse Bewusstsein überhaupt keine Rolle mehr: Blut und Herkunft determinieren gemäß dieser Weltanschauung das Handeln des einzelnen Juden, der einzelnen Jüdin. Ein Schlagwort der frühen antisemitischen Bewegung belegt das in Reimform: „Was er glaubt ist einerlei / im Blute liegt die Schweinerei!“ Dieser rassistische Judenhass war eine Folge der stets unvollständig gebliebenen bürgerlichen Emanzipation der Juden im westlichen und mittleren Europa des 19. Jahrhunderts.
Die neuzeitliche Debatte um das Verhältnis von Glaube und die mit der Reformation ins Bewusstsein tretende Möglichkeit, vor dem Hintergrund derselben heiligen Schriften unterschiedlichen, einander widerstreitenden Bekenntnissen angehören zu können, führte zum Auseinandertreten von zur „Konfession“ gewordenen Glauben und ethnischer Zugehörigkeit – der „natio“. Als mit dem Absolutismus die „natio“ zum im modernen Territorialstaat verfassten Volk, zur „Nation“ wurde, traten ethnische Zugehörigkeit und religiöses Bekenntnis endgültig auseinander. Glaube wandelte sich im modernen Nationalstaat vom öffentlich verbindlichen Brauch, dem Menschen fraglos, wenn auch nicht konsequent angehörten, zum individuellen, frei wählbaren Bekenntnis, zur „Konfession“.
Die Juden Westeuropas folgten diesem mit der französischen Revolution erstmals auch politisch beglaubigten Trend auch dort, wo sie sich den liberalen Umformungen des jüdischen Glaubens nicht anschließen mochten. Die konstitutionellen Monarchien oder Demokratien Westeuropas, die – wenn auch über Umwege und immer wieder von Rückschritten bedroht – allmählich die staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Juden durchsetzten, erklärten sie damit formell zu einer reinen Glaubensgemeinschaft im jeweiligen Nationalstaat, was zwar von den meisten Juden dankbar und beinahe übereifrig angenommen wurde, jedoch bald vom modernen Antisemitismus folgenreich immer wieder angegriffen wurde.
In Ost- und Mitteleuropa hingegen, vor allem im Herrschaftsbereich des zaristischen Russland, aber auch in den Donaufürstentümern Rumäniens, bleib das mittelalterliche Konzept einer weitgehenden Übereinstimmung von Ethnie und Religion weitgehend erhalten. Indem sich das Zarentum des späten 19. Jahrhunderts zur Abwehr revolutionärer und auch reformistischer Bestrebungen einer bewusst eingesetzten antisemitischen Propaganda bediente und darüber hinaus den jüdischen Untertanen des Zaren eine Fülle mal strenger, mal lockerer gehandhabter beruflicher Zugangs- und geographischer Mobilitätssperren auferlegte, war die Existenz der Juden im Zarenreich anders als in Westeuropa vor allem ethnisch grundiert. Das konfessionell nationalstaatliche Selbstverständnis der Juden Westeuropas hier sowie die kollektiv ethnische Identität der Juden des Zarenreiches dort, die sich nicht zuletzt in der endlich bewusst beibehaltenen jiddischen Sprache äußerte, hinderte den modernen Antisemitismus jedoch nicht daran, die Juden immer wieder ihrem traditionellen Selbstverständnis nach als Feind in den Blick zu nehmen. Dabei überschneiden sich traditioneller christlicher Antijudaismus und eine unwissenschaftlich weltanschauliche Übernahme aufklärerischer Perspektiven auf die Menschheit als biologischer Gattung, die sich weniger auf Darwin als auf den (Sozial-)Darwinismus bezog, nach dem die Menschheit in einander widerstreitende, im Kampf ums Dasein miteinander konkurrierende Rassen zerfällt. In dieser Ideologie werden die Juden als jene Rasse identifiziert, deren Existenzweise und Glaubensüberzeugungen Leben und Zukunft der anderen Rassen in besonderer Weise bedrohten und daher schließlich – im deutschen Nationalsozialismus – der systematischen Ausrottung preisgegeben wurden (vgl. Mosse 1993).
Dabei bediente sich der moderne Antisemitismus ohne auf besondere Trennschärfe bedacht zu sein, der „Argumente“ des traditionellen Antijudaismus mit seinem Vorwurf, die Juden seien Gottesmörder, Heilsverhinderer und Kinder des Satans. Dieser Antisemitismus entzündete sich am sozialen Aufstieg von Juden und schrieb ihnen die mit Kapitalisierung, Urbanisierung, Industrialisierung und Pauperismus nachteiligen Folgen kapitalistischer Entwicklung zu.
Bei alledem folgte das antisemitische Weltbild in Ost und West einem paranoiden Muster: es ist – angesichts der objektiven Komplexität der Verhältnisse – von der Suche nach geheimen Drahtziehern im Hintergrund besessen – das Aufdecken von einer vermeintlich konformistischen Mehrheitsmeinung verdeckt gehaltenen Ursachen ist seine Leidenschaft. Zudem neigt der Antisemitismus immer dazu, Einfluss, Macht und Anzahl von Juden systematisch zu überschätzen. Endlich schreibt der Antisemitismus den Juden in projektiver Wunscherfüllung ein Übermaß an Reichtum, sexueller Potenz, intellektueller Zersetzungskraft und internem Zusammenhalt zu (vgl. Benz 2004).
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat den oben geschilderten Formen des Antisemitismus zwei neue Varianten hinzugefügt, die zumal in Einwanderungsgesellschaften virulent werden: So klammern sich nationalistische, von der Globalisierung betroffene Rechtsextremisten an den Glauben, dass jene Tat, die den weltanschaulichen Antisemitismus ein für allemal diskreditierte, nämlich der Holocaust, selbst das Ergebnis einer lügenhaften Verschwörung mit keinem anderen Ziel sei, als den Widerstand der Völker gegen globalen Kapitalismus zu brechen, während umgekehrt vornehmlich, aber keineswegs ausschließlich, im muslimischen Immigrationsmilieu die Besatzungs- und Repressionspolitik der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern zur projektiven Bildfläche der im Einwanderungsland erfahrenen Ungerechtigkeit zu erklären. So schien etwa eine vom EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) beim Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung in Auftrag gegebene Studie davon zu zeugen. Die Ergebnisse der empirischen Sozialforschung stellen sich jedoch alles andere als eindeutig dar – sie zeigen, in unterschiedlichen Abschattierungen für unterschiedliche westeuropäischen Staaten, den üblichen Anteil von etwa 15-20% rechtsextremistisch und xenophob antwortender Befragter – Gruppen, die sich in aller Regel auch als mehr oder minder judenfeindlich erweisen. Den am meisten beunruhigenden Befund förderte noch eine Umfrage der US-amerikanischen „Anti Defamation League“ vom Oktober 2002 zu Tage, die für unterschiedliche europäische Länder insgesamt 21 Prozent deutliche Antisemiten fand.
Damit ist das Thema „Antisemitismus“ jedoch keineswegs vom Tisch – im Gegenteil. Wechselt man nämlich die Perspektive und löst sich vom starren Blick auf die Umfragen in westlichen Ländern, dann zeigt sich, dass weltweit durchaus antisemitische Massenbewegungen und Politiker wie zuletzt im Europa der Zwischenkriegszeit existieren. Sie finden sich freilich – mit Ausnahme Frankreichs und einiger Immigrantenmilieus in den Niederlanden, Belgien und Schweden – weniger in Europa als in der islamischen Welt. Von den Islamisten Algeriens im Westen, deren Führer Ali Belhadj „Kreuzfahrer und Zionisten“ mindestens so sehr hasste wie Osama bin Laden bis zum Indischen Ozean, wo der längst zurückgetretene malaysische Premier Mahatir gegen die palästinensischen Selbstmordattentäter wie zuletzt Adolf Hitler für einen Antisemitismus der Vernunft plädierte, während umgekehrt der iranische Präsident Ahmadinedschad vom Verschwinden Israels schwadroniert und die Entwicklung von Nuklearwaffen betreibt. Zudem: In Syrien und Ägypten liefen im staatlich kontrollierten Fernsehen unbeanstandet politische Soaps über die „Protokolle der Weisen von Zion“ sowie über jüdische Ritualmorde. Der israelische Historiker Yehuda Bauer hat in diesem Zusammenhang den radikalen Islamismus als dritte große totalitäre Bewegung neben den europäischen Faschismen und dem Stalinismus bezeichnet. Die ganz und gar moderne, eben nicht islamische, sondern eben islamistische Weltanschauung sieht im Koran ein Programm, das nicht nur Seligkeit im Jenseits, sondern auch eine gerechte Herrschaftsordnung, die den Kapitalismus in seine Schranken weist, mit absoluter Autorität gebietet. Diese Gedankenfigur unterscheidet sich vom darwinistischen Geschichtsglauben der europäischen Faschisten und dem Geschichtsdeterminismus der Stalinisten nur durch seine Inhalte. Der Form nach, im Glauben also, durch ein überhistorisches, ehern geltendes Gesetz einen demokratischer Entscheidungsfindung entzogenen Auftrag erhalten zu haben, der gegebenenfalls mit terroristischen Mitteln durchzusetzen ist, gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Wie im Nationalsozialismus und wie in der stalinistischen Polemik gegen das „Kosmopolitentum“ stehen auch hier die Juden als Feindbild fest. Während der Koran selbst im Stil spätantiker Religionspolemik zwischen einer Rhetorik der Verfluchung und des Verzeihens oszilliert, bedient sich der radikale Islamismus dessen negativster antijüdischer Aussagen und verfestigt sie zu einem rassistischen Stereotyp.
Die faktische Situation in Deutschland hat daher vor allem auf zwei Formen des Antisemitismus pädagogisch zu reagieren: Erstens, auf eine geschichtsklitternde Verharmlosung oder gar Verleugnung der nationalsozialistischen Verbrechen sowie eine Form der sogenannten „Israelkritik“, die Motive eines politisch
in Grenzen noch akzeptablen Antizionismus zu einer antisemitischen Welterklärungs- und Erlösungsstrategie umbildet. Etwa derart, dass wenn Israel von der Landkarte verschwände oder den Palästinensern Gerechtigkeit widerführe, der Frieden im Nahen Osten gesichert und damit auch die Lage muslimischer Immigranten im Westen deutlich verbessert werde (vgl. Faber et al. 2006). Die besondere Prägnanz und Brisanz der gegenwärtigen Situation dürfte darin bestehen, dass sich die weltanschaulichen Vorurteile deutsch-ethnischer Nationalisten und islamistisch gesonnener Immigrantenjugendlicher (vgl. Georgi 2003), bei aller sonstigen Feindschaft, in ihrer antisemitischen Ausrichtung überschneiden.
4. Welche Strategien?
Die Frage, welche Strategien im Kampf gegen Antisemitismus, zumal unter Angehörigen der jüngeren, spätestens Mitte der neunziger Jahre geborenen Generation, zumal aus muslimischen Immigrationsmilieus erfolgversprechend sind, hängt zunächst von Vermutungen über die Ursachen – auch und gerade in grundsätzlicher Perspektive – ab.
Sofern es sich bei antisemitischen Haltungen schlicht um sachliche Fehleinschätzungen bezüglich des Verhaltens, der Lebensumstände und Lebensweisen sowie sozialen Lage von Jüdinnen und Juden handelt, wäre nüchterne Information und das heißt Aufklärung im Sinn historischer und sozialwissenschaftlicher Information das Mittel der Wahl. So ließen sich in aller Regel weit übersteigerte Annahmen über den quantitativen Umfang der jüdischen Bevölkerung eines Landes, bezüglich des angeblich so engen Zusammenhalts aller Juden sowie bezüglich ihrer politischen Machtpositionen leicht durch die Präsentation der zutreffenden Faktenlage korrigieren. Freilich zeigt die Erfahrung und das ist auch der Kern der oben skizzierten sozialwissenschaftlichen Analyse, dass es beim Antisemitismus – also einem auf paranoiden Zügen beruhenden Weltbild, dessen Funktion es ist, Menschen in Situationen persönlichen oder sozialen Kontrollverlusts durch die Suggestion eines aufzudeckenden Geheimnisses und eines identifizierten unheimlichen Feindes Sicherheit zu verleihen – um mehr als um ein Bündel von Informationsdefiziten und lediglich kognitiven Vorurteilen handelt. Sofern es sich beim Antisemitismus um eine angsteindämmende und Kontrollverlust verhindernde Weltanschauung handelt, ist er auch emotional tief verankert und – das ist die Logik paranoider Konstrukte – gegen kognitive Widerlegungen zunächst tabu. Das lässt sich am Beispiel der Holocaustleugner belegen, die jeden weiteren Versuch, die historische Realität der Massenvernichtung durch evidente Beweise zu beglaubigen, nur als Beweis für die Richtigkeit ihrer Überzeugung ansehen: Dass die geheimen Mächte, die Deutschland seiner Ehre berauben wollen, immer mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um die Unwahrheit zu verbreiten, beweist doch lediglich, wie dünn und brüchig der Mythos von der Judenvernichtung sei. Oder: Der wiederkehrende Hinweis, dass ein bekannter Politiker, Schauspieler oder Autor kein Jude sei, belege doch nur, über welch raffinierte Taktiken „die Juden“ verfügen. Ein nationalistischer Autor der Weimarer Republik, Ernst Jünger, schrieb in diesem 1923 vom „Juden“ als dem „Meister aller Masken.“
5. Didaktische Prinzipien und methodische Fragen
Gleichwohl verbleibt den von öffentlichen – schulischen und außerschulischen – Institutionen betriebenen pädagogischen Strategien im Grundsatz keine Alternative zur Aufklärung; allerdings wird sie sich nicht nur auf das Beheben von Informationsdefiziten beschränken können. Sie werden vielmehr an den auch emotional verankerten Vorurteilsstrukturen ebenso ansetzen müssen, wie sie das Leiden der Opfer antisemitischer Verfolgung in einer dem jeweiligen Alter entsprechenden, Kinder und Jugendliche nicht überfordernden Weise einfühlsam präsentieren sollte.
Damit beruhen sinnvolle Strategien gegen Antisemitismus auf einem methodischen Dreieck, das erstens den Abbau von Informationsdefiziten und die Präsentation realer historischer und sozialer Lagen, zweitens die Konfrontation mit eigenen Vorurteilsstrukturen sowie drittens die Förderung von Empathie bezüglich der Opfer von antisemitischer, rassistischer und sexistischer Diskriminierung und Verfolgung umschreibt. Information, Umstrukturierung von Vorurteilshaltungen sowie Förderung von Empathie, das sind Aufgaben, die jeweils auch altersbezogen unterschiedlichen didaktischen und methodischen Prinzipien genügen sollten.
Es war, wie oben dargelegt, Theodor W. Adorno, der jenen Intentionen, die einer Erziehung und Bildung im Hinblick auf den Nationalsozialismus bis heute ihre bisher unübertroffene Artikulation gegeben hat. Die Frage nach der Möglichkeit didaktischer Vermittlung, also der Frage danach, wie dies Thema zu vermitteln sei sowie die Schwierigkeit, dass eine Erziehung nach Auschwitz immer auch eine Erziehung über Auschwitz ist, hatte sich Adorno nicht gestellt. Jahre der Erfahrung haben inzwischen die typischen Schwierigkeiten einer Erziehung nach Auschwitz deutlich werden lassen und zwar nicht zuletzt angesichts der für dieses Thema typischen Lehr- und Lernformen.
Als Lernorte beziehungsweise Lehr- und Lernformen gelten in diesem Zusammenhang zunächst sogenannte KZ-Gedenkstätten beziehungsweise Gedenkstätten auf dem Gelände ehemaliger, auf polnischem Territorium befindlicher nationalsozialistischer Vernichtungslager, sodann Besuche in einschlägigen (jüdischen) Museen sowie schließlich – in den letzten Jahren zunehmend beliebter – Unterrichtsbesuche beziehungsweise Gespräche mit Überlebenden, sogenannte Zeitzeugen – eine Konzeption, der indes aufgrund des unaufhaltsamen Alters dieser Generation ein absehbares Ende beschieden ist.1
Von LehrerInnen oder Instruktoren auf diesem Gebiet ist erstens zu erwarten, dass sie fachlich, mehr noch fachwissenschaftlich, bestens ausgewiesen und informiert sind. Die Komplexität der Thematik und der dem antisemitischen Vorurteil inhärente Hang zur Vereinfachung fordert umgekehrt die Bildung differenzierter und der Komplexität des Gegenstandes entsprechender Betrachtungsweisen. Das kann jedoch nur gelingen, wenn LehrerInnen sich dieser Komplexität durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff in all seinen historischen, soziologischen, psychologischen und auch theologischen Facetten ihrerseits versichert haben und ihn von der Sache her mehr oder minder souverän beherrschen. Dass Unterricht hier faktisch in große Schwierigkeiten geraten kann, hat die empirische Unterrichtsforschung eindrucksvoll bestätigt (vgl. Radtcke et al. 2000).
Des Weiteren ist zweitens eine grundsätzlich ebenso nachsichtige wie anerkennende, in der Sache indes eindeutige Haltung gegenüber Kinder und Jugendlichen, die antisemitische, antijudaistische oder auch undifferenziert antizionistische Haltungen zeigen oder Meinungen äußern, geboten. So sehr die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Opfern auch tiefsitzende moralische und politische Überzeugungen der Lehrpersonen und damit ihr ganzes existenzielles Engagement prägen mag, so sehr muss doch auch gelten, dass Kinder und Jugendliche, sogar wenn sie bereits mehr als vierzehn Jahre zählen, nicht der politische Gegner oder gar Feind sind, sondern – in dieser Hinsicht – das Ergebnis der Umstände, die sie geprägt haben. Antisemitischen Schülermeinungen ist in der Sache stets deutlich zu widersprechen – bei voller Anerkennung ihrer Person. Dass diese Einstellung gelegentlich eine hohe Selbstdisziplin erfordert, liegt auf der Hand. Freilich hängt der gewünschte Lernerfolg entscheidend von dieser Haltung ab: Emotionale, moralisierende Überreaktionen werden in den meisten Fällen jenen paranoiden Effekt zeitigen, durch den sich das antisemitische Ressentiment bestätigt sieht.
Endlich ist drittens, keineswegs nur bei Grundschulkindern die Gefahr der Überforderung (und auch Überrumpelung) zu berücksichtigen: Nicht nur die Konfrontation mit dem Holocaust, sondern jede durch die Präsentation des Leidens gewünschte Förderung von Empathie steht vor dem Problem, dass es beim Antisemitismus und seinen Opfern grundsätzlich um ein widriges, ein erschreckendes und beunruhigendes, Ängste auslösendes Thema geht. Die „natürlichen“, d.h. den Regularien des Aufwachsens in Gesellschaften unseres Typs entsprechenden Lebensabschnitte sehen trotz eines Medienkonsums, der immer häufiger durch die Rezeption gewaltsamer Darstellungen geprägt ist, eine intensive Konfrontation mit Leid und Schmerz nicht vor.
Inwiefern eine Pädagogik gegen nationalsozialistische, rassistische, sexistische, fremdenfeindliche und antisemitische Haltungen in der jüngeren Generation entweder in Erziehung zu Demokratie oder den Menschenrechten münden soll oder diese gar voraussetzt, ist aktuelles Thema der erziehungswissenschaftlichen Debatte (vgl. Brumlik 2004; International Network „Education for Democracy“ 2003).
Literaturhinweise
- Benz, Wolfgang. Was ist Antisemitismus? München 2004.
- Brumlik, Micha. Bildung und Glück. Versuch einer Theorie der Tugenden. Berlin 2002a.
Brumlik, Micha. Anerkennung als pädagogische Idee. In: Hafeneger, Benno et al. (Hg.): Pädagogik der Anerkennung. Schwalbach 2002b, S. 13-25. - Brumlik, Micha. Aus Katastrophen lernen? Grundlagen zeitgeschichtlicher Bildung in menschenrechtlicher Absicht. Berlin 2004.
- Faber, Klaus et al. (Hg.). Neu-alter Judenhass. Antisemitismus, arabisch-israelischer Konflikt und europäische Politik. Berlin 2006.
- Georgi, Viola B. Geschichtsbezüge in der deutschen Einwanderungsgesellschaft. Hamburg. Honneth, Axel (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt/M. 2003.
- International Network „Education for Democracy“ (Hg.). Tolerance matters. International Educational Approaches. Gütersloh 2003.
- Kant, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. In: Weischedel, Wilhelm (Hg.):
- Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Band 7. Darmstadt 1968.
- Levi, Primo. Ist das ein Mensch/Die Atempause. München 1986.
- Margalit, Avishai. Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Berlin 1996.
- Meseth, Wolfgang. Theodor W. Adornos „Erziehung nach Auschwitz“. Ein pädagogisches Programm und seine Wirkung. In: Fechler, Bernd et al. (Hg.): Erziehung nach Auschwitz in der multikulturellen Gesellschaft. Weinheim/München 2000.
- Mosse, George L. Die Geschichte des Rassismus in Europa. Frankfurt/M. 1995. Nickolai, Werner/Brumlik, Micha (Hg.). Erinnern, Lernen, Gedenken. Perspektiven der Gedenkstättenpädagogik. Freiburg 2007.
- Radtcke, Frank-Olaf et al. Vermittlung und Aneignung von Wissen über den Holocaust und Nationalsozialismus in der Schule. Frankfurt/M. 2000.
Wittmeier, Manfred. Internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz. Zur Pädagogik der Erinnerung in der politischen Bildung. Frankfurt/M. 1997. - Zumbini, Massimo F. Die Wurzeln des Bösen. Gründerjahre des Antisemitismus. Von der Bismarckzeit zu Hitler. Frankfurt/M. 2003.
Der Beitrag erschien zuletzt auf den Seiten von selma.ws