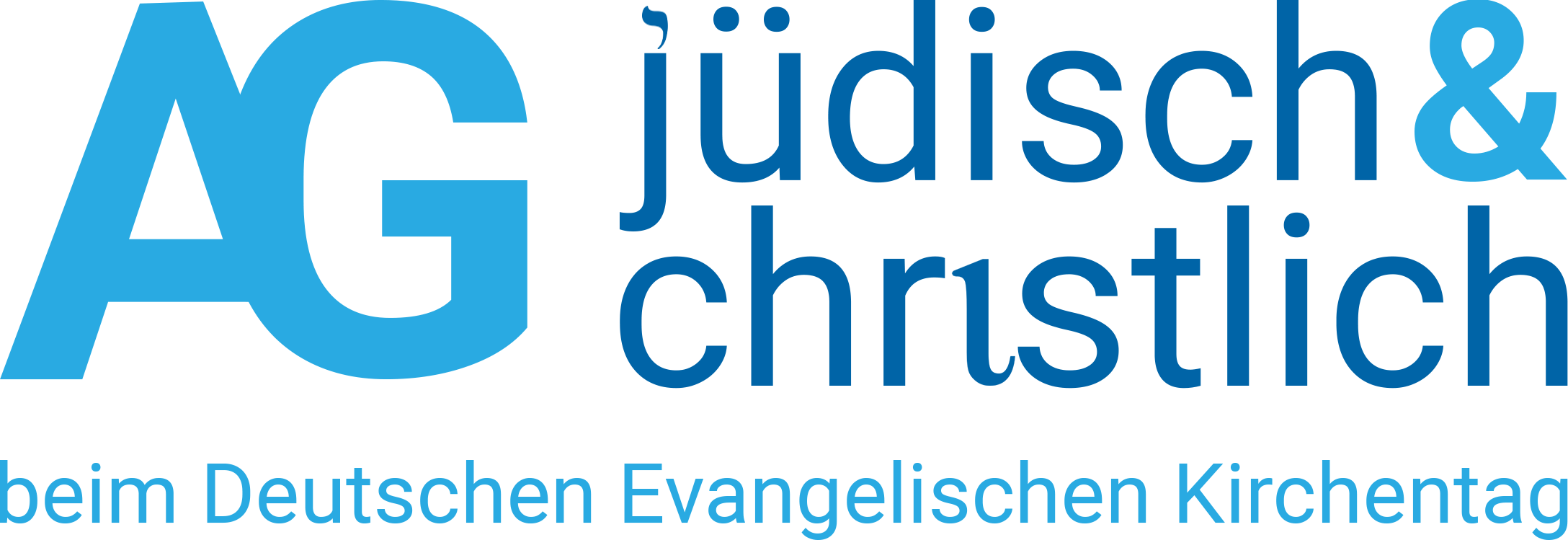Im rabbinischen Schrifttum findet sich seit dem 4. Jahrhundert eine Gruppe von Texten, die meist als »homiletische Midraschim« bezeichnet werden. Im Gegenüber zu den »exegetischen Midraschim« sind diese Sammlungen von Bibelauslegungen dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht Vers für Vers auf den Text der Heiligen Schrift eingehen, sondern zahlreiche Auslegungen um einzelne Verse gruppieren, andere Verse hingegen vollständig übergehen. Es spricht vieles für die Annahme, dass es sich bei den kommentierten Versen um die jeweils ersten Verse der Leseperikopen (Paraschot) der einzelnen Sabbate nach dem in Palästina üblichen Lesezyklus handelt und dass das in den homiletischen Midraschim gesammelte Material daher einen liturgischen Sitz im Leben hat.
Besonders auffällig erscheint in diesen Midraschim eine literarische Form, die allgemein Peticha genannt wird und sich nach einer Zählung Joseph Heinemanns mehr als 2000mal im rabbinischen Schrifttum landet. Eine Peticha endet mit dem biblischen Vers, von dem angenommen werden kann, dass er der erste Vers der Toralesung an dem jeweiligen Sabbat oder Feiertag war. Sie beginnt aber mit einem völlig anderen Bibelvers – meist aus den Ketubim, den »Schriften«, oder aus dem Corpus propheticum. Zwischen diesem entfernten Versa, mit dem die Peticha beginnt, und dem Lesevers spannt der Darschan (der Ausleger, Prediger) einen Bogen, indem er Einzelauslegungen, Gleichnisse oder kurze Erzählungen aneinander fügt.
Erste formkritische Untersuchungen zu den Petichot finden sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals ging man mehrheitlich davon aus, dass es sich bei der Peticha um die Einleitung zur synagogalen Predigt in rabbinischer Zeit gehandelt habe. Mehr und mehr aber nahmen Forscher die Eigenständigkeit der Petichot wahr – bis hin zu der These, die etwa Joseph Heinemann einflussreich vertrat, wonach es sich bei diesen
Petichot um die eigentlichen Deraschot in den Synagogen gehandelt habe.
Vorstellen könnte man sich dies dann etwa wie folgt: Jüdinnen und Juden kamen zum Gottesdienst zusammen. Wesentlicher Inhalt des Sabbatmorgengebets war die Lesung aus der Tora, die in lectio continua und in Palästina wohl in einem dreijährigen Turnus erfolgte. Geht man von einer relativ soliden Torakenntnis der Gottesdienstbesucher aus, dann kann man auch annehmen, dass die meisten – wenigstens grob – wussten, was an diesem Sabbat gelesen werden wird. Dann nahm der Gottesdienst seinen Lauf. Psalmen wurden gesungen, das SchmaJisrael gelesen, das am Sabbat gekürzte Achtzehngebet gesprochen. Im Anschluss trat der Darschan vor – und begann mit seiner Derascha. Noch vor der Lesung aus der Tora. Allerdings begann er nicht mit dem Vers aus der Tora, mit dem später die Lesung beginnen wird. Im Gegenteil: er begann und zitierte einen völlig anderen, weit abgelegenen Bilielvers. Die Zuhörer aber wussten: Seine Aufgabe wird es sein, mit den Worten der Derascha von diesem entfernten Vers hin zur Toralesung, die für diesen Sabbat vorgesehen war, zu gelangen. Eine Grundspannung war gegeben und ein Weg vorgezeichnet für die Derascha, ein Weg innerhalb des Textraumes der Hebräischen Bibel, des Tanach (Abkürzung für Tora, Nebiim [Propheten] und Ketubim [Schriften]).
Diese Vorgabe scheint zunächst rein formal. Aber natürlich wurden die Petichalemmata nicht willkürlich gewählt, sondern so, dass mit dem Petichalemma und der Tora-Parascha auch ein inhaltliches Spannungsfeld eröffnet war. Etwa, um nur ein Beispiel für eine Peticha zu nennen, ein inhaltliches Spannungsfeld zur Frage nach der »Topographie Gottes«, nach dem Ort, an dem Gott zu suchen ist. Da begann eine Peticha mit einem Lemma aus Ps 11: »JHWH, im Himmel ist sein Thron« (V. 4). Sie mündet dann aber in Ex 3, in die Erzählung von einem Gott, der sich in der Niedrigkeit eines Dornbusches in der Wüste offenbart. Zwischen Transzendenz und Immanenz Gottes bewegt sich die ganze Peticha – und lügt auf dem Weg von Ps 11 zu Ex 3 unterschiedliche Einzelauslegungen aneinander, erzählt Geschichten und ein Gleichnis.
Sahen die Deraschot in rabbinischer Zeit tatsächlich so aus? In der Judaistik sagen viele »Ja«, manche »Nein« – andere bleiben unentschieden dazwischen. Auf dem kurzen hier zur Verfügung stehenden Raum kann sicher keine Antwort gegeben und argumentativ entfaltet werden. Immerhin aber spricht m.E. der Regelbezug der Petichot auf die liturgisch perikopierte Tora deutlich für einen gottesdienstlichen Sitz im Leben dieser Texte. Und auf jeden Fall zeigen die Petichot, welche Hermeneutik die Derascha in rabbinischer Zeit grundlegend charakterisierte: Deraschot führten hinein in die Tora und verstrickten die Hörerinnen und Hörer in die Worte der Schrift. Sucht man einen Begriff, um diese Hermeneutik zu charakterisieren, so legt es sich m.E. nahe, sie als skripturale Hermeneutik zu bezeichnen. Der Ausleger redet nicht über die Schrift; er ermittelt nicht eine Aussage des Textes, sondern führt Wege hinein in die Sacra Scriptura.
Der berühmte Satz von Ben Bag Bag aus mAv 5,2 2 bringt diese skripturale Hermeneutik treffend auf den Punkt. Ben Bag Bag sagt: »Wende sie [die Tora, AD] um und wende sie um, denn alles ist in ihr.« Die Erwartung, »alles« in der Schrift zu finden, ist die Grundlage für eine akribisch genaue Lektüre des biblischen Textes. Einzelne Worte, ja sogar Buchstaben, werden untersucht. Vielfach werden verwandte Bibelstellen herangezogen, so dass sich eine Auslegung ergibt, die mit einem Leitwort aus der literaturwissenschaftlichen Diskussion des 20. Jahrhunderts als intertextuell bezeichnet werden könnte. Im Nachgehen der biblischen Worte und Erzählungen und in der intertextuellen Vernetzung mit anderen Texten erkennen die Ausleger, dass die Worte der Schrift nicht über Vergangenes sprechen, sondern es in ihnen um die Gegenwart des Gottesvolkes geht. Damit aber ist für rabbinische Auslegung gleichzeitig völlig klar, dass die biblischen Texte nicht nur die eine Aussage haben, die ein- für allemal ermittelt werden könnte. Im Gegenteil sind sie überzeugt, dass die Worte der Bibel durch eine Vielzahl der Interpretationen nicht an Bedeutung verlieren, sondern immer reicher werden. So meint etwa Abaje in einer Auslegung zu Bs 62,12 (»Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört…«): »[…] eine Bibelstelle hat mehrere Bedeutungen, nicht aber ist eine Bedeutung aus verschiedenen Bibelstellen zu entnehmen« (bSan 34a). Im Kontext des Talmud findet sich gleich danach ein Wort aus der Schule Rabbi Jischmaels: Wie das Wort Gottes als ein Hammer bezeichnet wird, der l eisen zerschmeißt (Jer 23,29), so seien die vielfältigen Auslegungen als die vielen Funken zu verstehen, die dabei entstehen. Im mittelalterlichen Midrasch BemR heißt es dann, die Tora habe siebzig Gesichter und damit letztlich unendlich viele Möglichkeiten, gegenwärtige Hörer und Leser
›anzublicken‹ (BemR Naso 13,15).
Zusammenfassend kann das, was skripturale Hermeneutik in rabbinischer Zeit bedeutet, durch die vier Begriffe Genauigkeit, Intertextualität, Aktualität und Pluralität m.E. treffend charakterisiert werden. Die rabbinischen Texte – und ganz besonders die Petichot – führen eine Auslegung eindrucksvoll vor Augen, die voller Erwartung die Tora genau befragt und gegenwärtige Hörer/Leser vielfältig in die Worte und Geschichten der Tora verstrickt.
An die rabbinische Zeit schließt sich das jüdische Mittelalter an – eine Epoche, in der sehr viele Deraschot veröffentlicht wurden und auch erste homiletische Anleitungsbücher entstanden. Hermeneutisch wird in jenen Jahrhunderten ein Umbruch greifbar, der plakativ als der Weg von einer skripturalen zu einer meta-skripturalen Hermeneutik charakterisiert werden könnte: Vor allem die karäische Kritik an der Art und Weise rabbinischer Schriftauslegung und die Einflüsse durch die Rezeption primär aristotelischer Philosophie führten dazu, dass viele mittelalterliche Deraschot vor allem philosophische oder ethische Aussagen entwickeln und diese durch Belege aus der Schrift begründen. Plakativ gesagt kehrte sich die hermeneutische Richtung gegenüber der rabbinischen Zeit um: Die Derascha führt nicht mehr hinein in die Tora und in die widersprüchliche Vielfalt unterschiedlicher »Funken«, die sich ergeben, wenn die Steine der Worte und Buchstaben sorgfältig behauen werden, sondern führt aus der Tora heraus zur begründeten philosophischen oder ethischen Aussage. Daneben entwickelte sich eine dritte wesentliche Richtung der Derascha im jüdischen Mittelalter: die mystische Predigt. Auch deren Hermeneutik kann insofern als meta-skriptural bezeichnet werden, als mystische Ausleger versuchten, gleichsam durch die Worte der Schrift und die Vielfalt der Auslegungen hindurch zum eigentlichen Grund der hinter den Buchstaben verborgenen Fora, zur unio mystica, vorzustoßen. Philosophische, ethische und mystische Predigt – jede dieser Entwicklungen würde es rechtfertigen, je für sich genau beleuchtet zu werden. Dazu allerdings fehlt hier der Raum, weswegen ich einen gewaltigen Sprung mache und mit der modernen jüdischen Predigt, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelte, fortfahre.