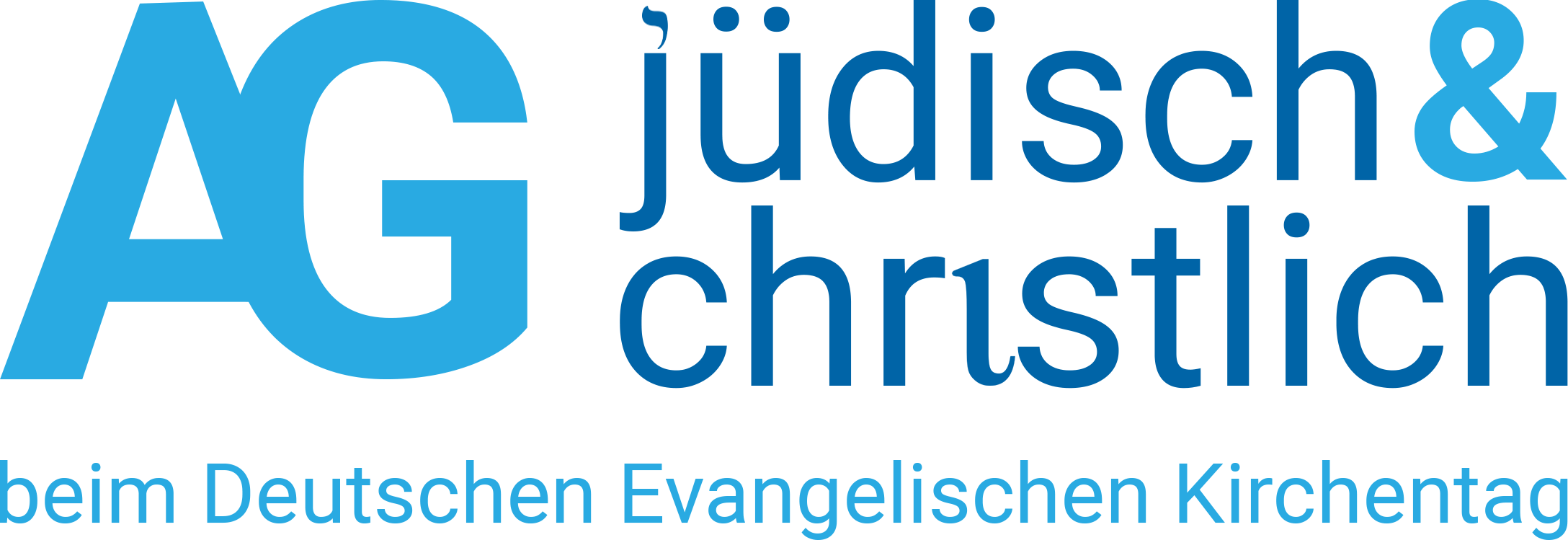Das Eigene und das Andere
Die gegenwärtige Bedeutung des jüdisch-christlichen Gesprächs
Frederek Musall und Jonas Leipziger
Im Anfang ist die Beziehung« (Martin Buber, Ich und Du). Mit Martin Buber ins Haus zu fallen, hat im Rahmen des jüdisch-christlichen Gesprächs ja irgendwie Tradition, ist aber auch ebenso vorhersehbar wie redundant. Trotzdem drückt dieses Zitat für die im Folgenden skizzierten Gedanken etwas Grundlegendes aus: nämlich, dass es im jüdisch-christlichen Gespräch von Beginn an ein bewusstes In-Beziehung-Setzen gibt. Ein Dialog ist aber mehr als nur bloße Begegnung im Gespräch; er ist die bewusste Bereitschaft und Entscheidung, sich selbst zu hinterfragen.
In verschiedenen, vor allem judaistischen Arbeiten der letzten Jahrzehnte wurde deutlich, dass die Anfänge von Judentum und Christentum in der Spätantike neu zu denken sind. Insbesondere Forschungen von Daniel Boyarin und Peter Schäfer haben die Beziehungen zwischen Judentum und Christentum in der Antike neu beleuchtet. Diese haben für unser Verständnis der spätantiken Ursprünge der beginnenden Trennung von dem, was wir heute als (rabbinisches) Judentum und als Christentum kennen, einen Paradigmenwechsel eingeleitet.
Daniel Boyarins Werk hat sicherlich am stärksten dazu beigetragen, unsere geprägten Vorstellungen von den Anfängen von Christentum und Judentum und vom sogenannten »Parting of the Ways«, dem Auseinandergehen der Wege von Judentum und Christentum, neu zu zeichnen.
So ist deren gemeinsame Geschichte in der Spätantike bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts n.d.Z. offen sowie verflochten und stellt einen wechselseitigen Prozess der Ausdifferenzierung dar – demnach entstand das Christentum weder mit Jesus noch mit Paulus: Das Trennen der Wege ist ein Ergebnis von gegenseitigen Beeinflussungen in den ersten Jahrhunderten, in denen gerade noch keine Trennung vorhanden ist, in denen man noch nicht von den uns bekannten Entitäten »Christentum« und »Judentum« als voneinander verschiedenen Religionen ausgehen kann. Erst am Ende eines langen Prozesses entwickelte sich, so Boyarin, im 4. Jahrhundert die Ausdifferenzierung in das rabbinische Judentum auf der einen Seite und das orthodoxe Christentum auf der anderen Seite.
Tochterreligionen
Angesichts dieser Erkenntnisse scheint auch das lange gepflegte »Mutter-Tochter-Modell« von Mutter Israel und Tochter Christentum diese historischen Entwicklungen nicht mehr adäquat beschreiben zu können; eher sind beide »Tochterreligionen«, die beide aus dem biblischen Judentum hervorgingen. Boyarin geht sogar so weit und sagt, »dass alles, was traditionell als Christentum identifiziert wurde, im Einzelnen auch schon in einigen jüdischen Bewegungen [neben der Jesus-Bewegung] im ersten Jahrhundert und später existiert hat«.
Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse über die geschwisterlichen Ursprünge von Judentum und
Christentum sind bislang noch nicht ansatzweise von der universitären Theorie in die religiöse Praxis der Religionsgemeinschaften transformiert worden: So kann es unseres Erachtens nach nicht dabei bleiben, dass, frei nach Karl Kraus, der Ursprung das Ziel ist und bleibt; jene Erkenntnisse über die langen und engen – und in der weiteren Entwicklung von Spätantike über das Mittelalter bis in die Neuzeit auch für das Judentum dann auch bekannterweise bedrohlichen und antijüdischen – Verflechtungen sind wichtig und müssen zur Kenntnis genommen werden. Aber dabei sollte es nicht bleiben: Es stellt sich die Frage, was in der Gegenwart im gemeinsamen Miteinander der Religionen aus jenem Wissen gemacht wird; wie das gemeinsame Gespräch gestaltet wird; wie das Miteinander angesichts von Gemeinsamkeiten und bleibenden Differenzen ausgehandelt wird.
Schlaglichter
Wir beide sind wie andere Angehörige der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg auch in verschiedenen Kontexten in interreligiöse Gespräche involviert. Einige Schlaglichter dieses Engagements – hier im jüdisch-christlichen Gespräch – sollen jene Diskurse verdeutlichen:
1.) In den sich nähernden evangelischen Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum 2017, das an den sogenannten Thesenanschlag des Wittenberger Reformators Martin Luther erinnern wird, kulminieren verschiedene Themen: Wie präsentiert die Evangelische Kirche in Deutschland ihr Selbstverständnis auch und gerade angesichts der bekannten antijüdischen Schriften, gar des antijüdischen Werkes Martin Luthers? Wie geht sie mit antijüdischen Topoi der Theologie Luthers und anderer Reformatoren um? Welche Schlüsse werden für das gegenwärtige theologische Selbstverständnis gezogen?
So werden auch jüdische Gesprächspartner im jüdisch-christlichen Gespräch immer wieder herausgefordert – und müssen zunächst einmal auch erst in einem Lernprozess verstehen lernen, was nun beispielsweise Luthers Rechtfertigungslehre
an theologiebildenden Implikationen alles enthält. Gleichzeitig meinen wir, es reicht nicht aus, dass sich die Kirchen in Deutschland von Luthers Antijudaismus / frühneuzeitlichem Antisemitismus »nur« distanzieren oder diesen gar zu relativieren suchen: So müssten auf noch breiterer Basis als bisher protestantisch-theologische Themen neu durchdacht werden, wie das Verhältnis von »Gesetz« und »Evangelium«, die klassische Rechtfertigungslehre oder die Verhältnissetzung von Hebräischer Bibel zum Neuen Testament. Die Arbeit im jüdisch-christlichen Gespräch zeigt, wie fruchtbar und wie inspirierend solche Revisionen theologischer Denkmuster sein können.
2.) Sie zeigt auch, wie wichtig es ist, genau zu differenzieren: So ist zu bedauern, dass auf christlicher Seite noch zu selten wahrgenommen wird, dass Juden und Christen zwar die Hebräische Bibel/das »Alte Testament« als gemeinsame Grundlage teilen, dass aber in ihrer Rezeptionsgeschichte der Zugriff daraus ein ganz anderer geworden ist; dass es gerade nicht ausreicht, mit Bibelversen (d.h. durch die schriftliche Tora) jüdische Traditionen zu verstehen, sondern dass erst die rabbinische und die rabbinisch geprägte jüdische Traditions- und Rezeptionsgeschichte (d.h. als mündliche Tora) das Judentum in seiner Vielfalt bis heute widerspiegelt.
3.) Das gemeinsame Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern im Frankfurter Graduiertenkolleg »Theologie als Wissenschaft«, in dem Promovierende aus den jüdischen, muslimischen und christlichen Theologien arbeiten, zeigt, wie spannend die gemeinsame kritische Analyse von Glaubenstraditionen ist. So wird hier beispielhaft deutlich, dass auch solche fundamentalen Begriffe wie »Tradition«, »Heilige Schrift«, »Kanon« oder »Offenbarung«, von denen man meinen könnte, sie seien doch in den jeweiligen Religionsgemeinschaften klar und offensichtlich, auch immer wieder von Neuem zu analysieren sind.
4.) Daher sind Räume für ein gemeinsames interreligiöses Diskutieren so bedeutsam: als Werkstatt/Laboratorium, in dem Ideen für Kritik und Selbstkritik entstehen, um theologische und gesellschaftliche Revisionen vorzunehmen, um unser Verhältnis als Juden und Christen im Besonderen und der Religionsgemeinschaften im Allgemeinen immer wieder neu auszuhandeln; und um im und für ein Miteinander sprachfähig zu werden.
Distanz
Gerade die aktuellen Ereignisse in Deutschland zeigen, wie wichtig solche Räume eines interreligiösen Miteinanders sind und wie wichtig auch neue Formen des Diskurses werden; neue Formen, die dazu motivieren, immer wieder neue Blickwinkel auf das religiös »Andere« zu suchen und einzunehmen; die Raum geben, um die Positionen des Eigenen in Bezug auf das Andere zu verändern. Und ähnlich wie im Kino bedarf es eben manchmal auch der Distanz – gerade der Distanz zum Eigenen –, um das auf der Leinwand Abgebildete zu erfassen. Denn die durch das interreligiöse Gespräch eingegangene Beziehung ist ein dialektisches Verhältnis, welches sich nicht nur durch die beiden Pole Eigenes und Anderes ausdrückt, sondern ein oszillierendes Spektrum von Positionen und Optionen eröffnet. Was im Gegenzug aber auch erfordert, dass man die daraus resultierenden Spannungen auszuhalten lernt.
5.) Dennoch begegnet man immer wieder auch Asymmetrien in der Gesprächsarbeit, die sich nicht so einfach auslösen lassen: Juden sind gewöhnlich in der Unterzahl, und dann sitzen sie häufig noch mehreren Theologen gegenüber, als ausgebildeten Religionsexperten. Folglich passiert es nicht selten, dass man im Gespräch dann doch nicht die gleiche Sprache spricht.
Und schließlich gilt es zu bedenken, dass sich Religionen in der Moderne trotz deren entsprechender Suche und Streben nicht auf Eindeutigkeit(en) reduzieren lassen. Denn man stößt immer häufiger auf andere Erscheinungs- und Ausdrucksformen des Religiösen als die gewohnten, die etwa religiöse Traditionsliteratur in anderen Rezeptionsmedien (Comic, Film, Internet) artikulieren und nicht selten ein neues religiöses Selbstverständnis ausformen.
Dennoch, das christlich-jüdische Gespräch blickt auf einen wichtigen und radikalen Paradigmenwechsel gerade innerhalb christlicher Theologie(n) und Kirche(n) im 20. Jahrhundert zurück. Aber es sind zunehmend auch die Herausforderungen der pluralen Gesellschaft, die Juden, Muslime und Christen als gesellschaftliche Akteure in die Verantwortung nimmt im gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus, Islamophobie, Rassismus und andere Formen sozialer Ausgrenzung. Wodurch deutlich wird, dass sich das bewusste Miteinander in gemeinsamen Zielen formulieren sollte. Von daher besteht der nächste anzustrebende Paradigmenwechsel vielleicht ja darin, das jüdisch-christliche Gespräch endlich in den Rahmen »Religion in der pluralen Gesellschaft« einzubetten und dort zu verorten.
Zuerst veröffentlich in der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung.