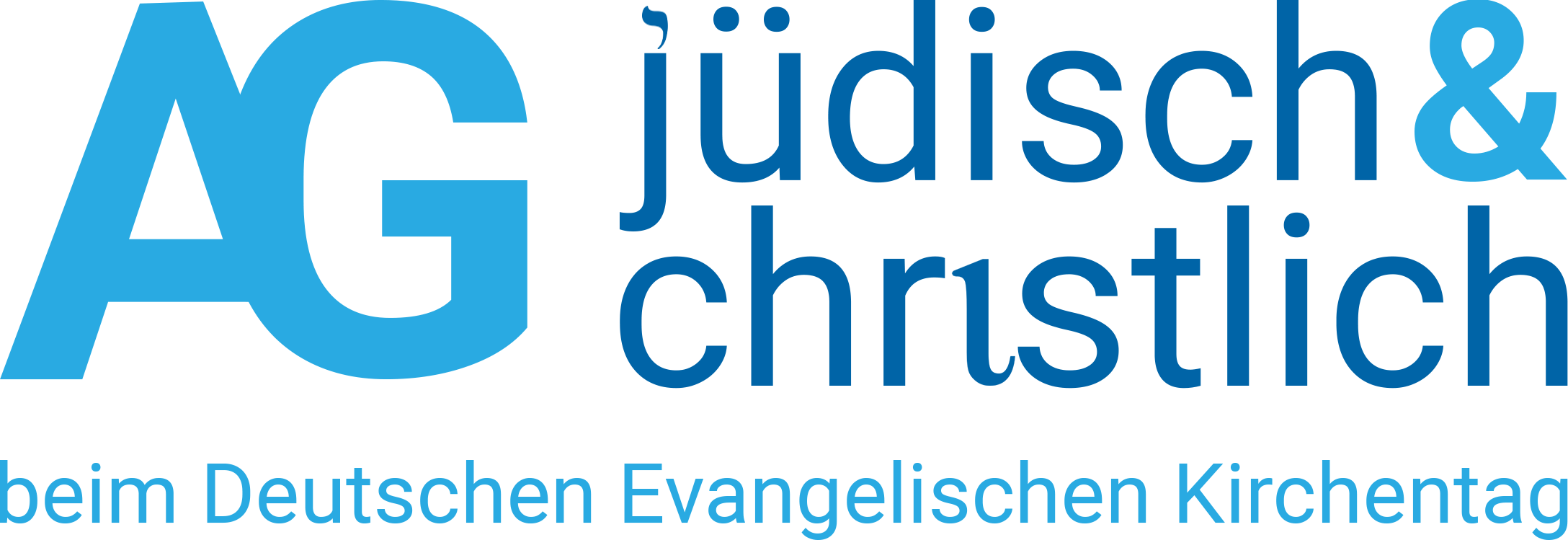Fragen und Antworten zum jüdisch-christlichen Verhältnis
Diese Fragen zum jüdisch-christlichen Dialog sowie Antworten dazu finden Sie hier – in nicht ganz 140 Zeichen:
Wir stellen auf den Kirchentagen fest, dass uns die BesucherInnen wiederholt Fragen stellen die sich thematisch mit dem Judentum oder dem jüdisch-christlichen Verhältnis befassen. Da sich viele der Fragen ähneln, stellen wir eine Reihe von ihnen hier vor und schlagen entsprechende Antworten vor.
Eine kurze Antwort auf diese Frage könnte heißen: Genau deshalb.
Erstens ist im Neuen Testament schon deutlich, dass es im 1. Jahrhundert innerjüdische Konflikte gab, über den Weg gegenüber Rom und nach der Zerstörung des Tempels. Das, was oft als ein christlich jüdischer Konflikt beschrieben wird, ist in Wahrheit ein innerjüdischer. Denn nicht nur Jesus war Jude, sondern auch die ersten Christen waren Juden. Als Christentum und Judentum getrennt Wege gingen, begann im Christentum ein Prozess ein Negativbild vom Judentum zu entwickeln. Geprägt war dieser Prozess, dass das eigene Negative, Abgründige, Unsichere, Glaubensproblem auf die Juden projiziert wurde. Wenn „die Juden“ dunkel waren, strahlte der eigene Glauben.
Da ist zunächst der klassische und tatsächlich schon im Neuen Testament angelegte Vorwurf des Gottesmordes. Dies setzt erstens voraus, dass Jesu Tod am Kreuz nicht den Römischen Behörden, sondern den Juden zugeschrieben, sowie zweitens dass Jesus Christus als Sohn Gottes und damit gottgleich verstanden wird. Beides ist biblisch und historisch kaum zu belegen und weist auf eine spätere (un-)heilsgeschichtliche Erzählung. Die innere christliche Logik des Todes von Jesus Christus als durch seine Auferweckung bestätigtes Heilsgeschehen an Juden und den Völkern, also allen Menschen wird mit dem Mordvorwurf konterkariert. Zugespitzt und theologisch etwas unterkomplex gesagt: Wäre es Mord, dann kein Erlösungsgeschehen, ist es ein Erlösungsgeschehen, dann sind die Verantwortlichen zumindest Werkzeuge Gottes im Sinne des geglaubten Erlösungsgeschehens. Der Gottesmordvorwurf an die Juden korrespondiert mit der für die spätere Kirche kränkenden Tatsache, dass die meisten Juden und Jüdinnen sich nicht zu dem neuen Glauben an den Messias Jesus bekannten. Vielleicht aber dient der Gottesmordvorwurf aber auch dazu die eigenen Mühen im Glauben daran, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch sei, gleichsam ex negativo.
Das angebliche Verratsmotiv des Judas ist wiederum eine Steigerung in diesem der inneren Logik des als Teil des göttlichen Heilsgeschehen verstandenen Todes Jesus widerstreitenden Glaubens- und Denkmodell. Judas verrät Jesus angeblich durch einen den römischen Soldaten markierenden Kuss. Der Bruch mit der inneren Logik des Heilsgeschehens ist bereits erwähnt. Die zweite Irritation entsteht, wenn wir wissen, dass Jesus ja schon einige Berühmtheit erlangt hatte, die Sicherheitsbehörden als kaum auf ein körperliches Signal zur Markierung des zu Ergreifenden angewiesen waren. Dass für diese Markierung auch noch Geld bezahlt worden sein soll, ergänzt die Theorie der Verstrickung und sie endet fast notwendig mit der Bestätigung des Bösen durch seinen Selbstmord.
Für die Kirchenväter der alten Kirche wurde dann Judas zum Sinnbild für die Juden.
Was sich im Einzelnen als Geschichte des Judas darstellt, ist generell die Geschichte der Juden. […]Wer sind wohl die Söhne von Judas? Die Juden. Die Juden tragen nämlich ihren Namen nicht nach Juda [dem Sohn Jakobs], der ein heiliger Mann war, sondern nach dem Verräter Judas. In der Linie von Juda sind wir [Christen] Juden im Geiste – in der Linie des Verräters Judas aber stehen die Juden nach dem Fleisch.«
Juden sind also nach dieser Lesart nicht nur Nachfolger des Judas und damit eben auch die Gottes-Verräter, sondern eben fortan das umfassend negative Gegenbild zu den Christen. Alt gegen neu, Fleisch gegen Geist, Gesetz gegen Gnade, Rache gegen Liebe und in moderneren Zeiten unter anderem direkt an diese Dualismen anschließend Partikularität gegen Universalität und Gewalt gegen Gewaltlosigkeit. Diese Dualismen währen bis heute und sind untergründig eine Verlängerung jenes kirchengeschichtlich gewachsenen Judenhasses.
Dr. Christian Staffa
Moderne Menschen, meint der Historiker aus Berkeley Yuri Slezkine in seinem Weltbestseller The Jewish Century, seien urban, flexibel, gebildet und kultiviert geworden. Kurz: Sie seien »jüdisch« geworden.
Moderne christliche Menschen sind in Deutschland schuldbewusst (Holocaust und das Schweigen bzw. die Mittäterschaft der Millionen von Christen), sozial, nicht sonderlich spirituell und meistens philosemitisch geworden. Sie sind keine »Juden«, sie brauchen das Judentum aber für eine Selbstlegitimierung – und für eine Legitimierung des (post)christlichen Europas. Die Christen in Deutschland wissen vergleichsweise viel über das Judentum. Das Christliche ist heute keinesfalls jüdisch. Sehr oft ist es aber auch nicht christlich. Sowohl jüdische als auch christliche religiöse Inhalte sind aktuell nicht von großem Interesse.
Das Jüdische ist in Deutschland – oh Paradox! – stark christlich geprägt, vor allem durch die staatskirchenrechtliche Organisationsstruktur der Gemeinschaft. Doch das Interesse am Christentum hält sich im jüdischen Milieu eher in überschaubaren Grenzen. Das betrifft auch die Mehrheitsgesellschaft. Der christliche Antijudaismus und der moderne Antisemitismus haben zahlreiche religiöse und kulturelle Einflüsse des antiken, mittelalterlichen und modernen Christentums auf das Judentum und die gegenseitige Bereicherung der Religionen gesellschaftlich irrelevant gemacht. Das hat weniger mit der Geschichte zu tun – das hat vor allem mit der Erinnerung sowie mit den Konventionen der heutigen Gesellschaft zu tun.
Die »Geschwister«, so werden Juden und Christen heute nicht selten genannt, leben ein Leben einer sich kaum registrierenden Nachbarschaft. In den seltenen Fällen, besonders wenn die politischen Randalierer mit ihrem antiislamischen »jüdisch-christlichen Abendland« die gesellschaftliche »WG-Küche« laut betreten, wird gemeinsam dagegen argumentiert. Ansonsten wird viel Symbolpolitik betrieben. Ein freundliches Desinteresse überwiegt
Wir müssen reden. Auch über gegenseitige Beeinflussungen und die zahlreichen Widersprüche.
Dafür ist der Kirchentag gut.
Dr. Dmitrij Belkin
Leider kann man in Deutschland (fast überall) Ev. Theologie auf Lehramt oder auf Pfarramt studieren ohne sich mit dem Judentum oder Themen des jüdisch-christlichen Dialogs zu beschäftigen.
Die AG Juden und Christen und der Lehrstuhl für Religionspädagogik und Bildungsforschung der Universität Göttingen haben gemeinsam ein „Projekt zur Analyse der Curricula des Studiums der Evangelischen Theologie für Pfarramt und Lehramt in Bezug auf jüdische und/oder jüdisch-christliche Lehrinhalte“ durchgeführt. Hierbei ging es zunächst um eine Bestandsaufnahme, ob, und wenn ja, in welchem Umfang und mit welchen Inhalten sowohl „Judentum“ als auch das „jüdisch-christliche Verhältnis“ in den das Studium der evangelischen Theologie strukturierenden Curricula bzw. Modulkatalogen thematisiert werden. Hierfür wurden sowohl das Pfarramtsstudium als auch die Lehramtsstudiengänge Evangelische Religion einer Analyse unterzogen.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass man in Deutschland Evangelische Theologie studieren kann ohne sich mit dem Judentum zu beschäftigen:
- Es gibt an theologischen Fakultäten in Deutschland fast keine obligatorischen, also verpflichtenden, Lehrveranstaltungen im Bereich Judaistik.
- Es gibt keine obligatorischen Veranstaltungen im Bereich des jüdisch-christlichen Dialogs.
- Im Wahlpflichtbereich gibt es an den meisten Fakultäten einige fakultative Veranstaltungen im Bereich Judaistik und/oder jüdisch-christlicher Dialog.
Die weiteren Ergebnisse der Studie kann man hier abrufen.
Marie Hecke
1. Wie die gestellte Frage eine sinnvolle sein kann
In der Titelfrage steht ein „Wir“, das im Zentrum „Juden und Christen“ selbstverständlich Juden und Christen meint. Die Frage, ob Juden und Christen dieselbe Bibel lesen, ließe sich schnell mit „Nein“ beantworten. Sie können gar nicht dieselbe Bibel lesen, weil sie nicht dieselbe Bibel haben, sondern unterschiedliche Bibeln. Das ist richtig. Aber es macht die Frage nicht zu einer sinnlos gestellten. Was nämlich zu dieser Frage herausfordert, ist die religionsgeschichtliche Eigentümlichkeit und Einmaligkeit, dass die heiligen Schriften einer Religionsgemeinschaft zugleich Teil der heiligen Schriften einer anderen Religionsgemeinschaft sind. Unbeschadet dessen, dass der Umfang des Alten Testaments in den christlichen Konfessionsfamilien unterschiedlich groß ist und es Abweichungen in der Reihenfolge einzelner Schriften zwischen der jüdischen Bibel und dem Alten Testament gibt, gilt doch: Die jüdische Bibel findet sich ihrem ganzen Umfang nach in der christlichen Bibel wieder. Was bedeutet das für die christliche Lektüre der Bibel? Was bedeutet es für Christinnen und Christen, dass der erste Teil ihrer Bibel zuvor jüdische Bibel war und es auch weiterhin ist? Ist das nur ein formaler Aspekt ohne inhaltliche Bedeutung oder hat er theologisches Gewicht? Evangelisches Christentum weiß sich die Schrift als primäre Norm vorgegeben. Ich bin evangelischer Neutestamentler. So bin ich doppelt darauf verwiesen, mich bei dieser Frage an das Neue Testament zu halten. Es ist dann auch zugleich die Frage nach dem Verhältnis des Neuen Testaments zum Alten – und diese Fragen versuche ich vom Neuen Testament her zu beantworten.
2. Die Schrift als Raum des Evangeliums
Wenn ich das Neue Testament aufmerksam lese, merke ich: Ich werde von diesen Schriften selbst auf das Alte Testament verwiesen, genauer: auf die jüdische Bibel. Es ist die Binsenweisheit zu beachten: Als die Autoren der Schriften, die später zum Neuen Testament zusammengestellt wurden, diese verfassten, gab es noch kein Neues Testament. Sie schrieben auch nicht in dem Bewusstsein, damit an einer neuen oder auch nur zu ergänzenden Bibel zu arbeiten. Was es aber ganz selbstverständlich für sie gab, war die jüdische Bibel, waren die in ihrer Zeit als heilig geltenden Schriften. Dass sie in und mit ihrer Bibel lebten, zeigt sich in ihren eigenen Werken, sodass wir diese gar nicht ohne ihre Bibel verstehen können. Das sei am Beispiel der Evangelien kurz skizziert.
Immer wieder finden sich in ihnen Zitate aus der jüdischen Bibel und Anspielungen auf sie. Man wird geradezu sagen müssen: Die Evangelisten erzählen die Geschichte Jesu mit ihrer Bibel, in besonderer Dichte in den Passionsgeschichten. Es ist vorauszusetzen, dass sie wussten, was sie taten, dass also ihr Erzählen mit der Bibel ein bewusst eingesetztes Mittel literarischer Gestaltung ist, das einer theologischen Intention dient. In diesem Erzählen mit der Bibel wird Gott ins Spiel gebracht. Gegenüber den geschichtlich mit tödlicher Gewalt handelnden Subjekten wird hier behauptet, dass ein ganz anderer das entscheidende Subjekt sei, das seine Finger im Spiel habe und dem mit der Kreuzigung Jesu endenden schlimmen Geschehen eine andere Wendung gebe. Nochmals: Die Evangelisten schreiben die Geschichte Jesu mit ihrer Bibel. Das leistet es, dass sie den in ihrer Bibel bezeugten Gott als in der Geschichte Jesu wirkend bezeugen können. Damit ist zugleich deutlich, dass ihre heilige Schrift, die jüdische Bibel, der Raum des Evangeliums ist, sein Sprach- und Wahrheitsraum.
3. Das Alte Testament als Vor-Gabe: Wer unser Gott ist
Aufgrund des im vorigen Abschnitt Ausgeführten ist der immer wieder begegnende isolierte Gebrauch des Neuen Testaments ein Missbrauch, ein Unding; er entspricht nicht dem Usus der Kirche. Die letzte von Luther zu seinen Lebzeiten herausgegebene deutsche Bibel hat den Titel: „Biblia: Das ist: die gantze Heilige Schrift“. Vom 17. Jahrhundert bis zur Revision von 1912 lautete er präzisiert: „Die ganze heilige Schrift Alten und Neuen Testaments“. Dass die jüdische Bibel erster Teil der christlichen Bibel ist, darüber wurde in der Geschichte der Kirche nie entschieden oder gar abgestimmt. Sie war schlicht und einfach schon da, in jedem Sinn des Wortes: Vor-Gabe. Wer das in Frage stellte, wie schon in der Mitte des 2. Jahrhunderts Markion, wurde aus der Kirche ausgeschlossen. Mit der selbstverständlichen Vor-Gabe der jüdischen Bibel als dem Alten Testament der Kirche war aber von vornherein über die in meinen Augen wichtigste theologische Frage entschieden, wer nämlich für die Kirche Gott ist. Es ist der in dieser Bibel bezeugte Gott. Der ist gewiss als Schöpfer der Gott aller Welt, aber er ist kein Allerweltsgott, sondern Israels Gott, dem es gefallen hat und weiter gefällt, mit diesem Volk seine besondere Bundesgeschichte zu haben. Dafür brauchen Christinnen und Christen das Alte Testament: um zu wissen, wer Gott ist. Um mit Blaise Pascal zu sprechen: „Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und nicht der Gott der Philosophen.“ Das unterscheidet ja biblisches Reden von Gott vom philosophischen, dass es zwar selbstverständlich den einen Gott auf die ganze Wirklichkeit bezieht, ihn aber mit bestimmter, dazu noch höchst partikularer Geschichte in unlösbaren Zusammenhang bringt: im Alten Testament, in der jüdischen Bibel, mit der Geschichte des Volkes Israel, im Neuen mit der Geschichte eines Menschen aus Israel, dem Juden Jesus aus Nazaret, der aber nicht losgelöst von seinem Volk, sondern in ihm gelebt hat.
Dass der in der Bibel bezeugte Gott Israels Gott ist und bleibt, ist in der Geschichte der Kirche weithin vergessen und verdrängt worden – vor allem dadurch, dass die Kirche den Begriff „Israel“ für sich selbst usurpierte und sich als das „wahre Israel“ behauptete. In dieser Perspektive wurde das außerhalb der Kirche weiter existierende Judentum zum „falschen“ Israel, das es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Das hatte immer wieder mörderische Konsequenzen. Hier hat inzwischen ein Umdenken begonnen. Es ist entdeckt worden, dass auch nach dem Neuen Testament Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel mit Jesus nicht beendet ist, sondern weitergeht, dass das Jesus ignorierende Judentum das von Gott geliebte Volk ist und bleibt. So ist es keine Nebensächlichkeit, dass auch im Neuen Testament Gott ausdrücklich als Gott Israels bezeichnet wird.
Von der Erkenntnis her, dass der im Neuen Testament bezeugte Gott kein anderer ist als der in der jüdischen Bibel bezeugte und also Israels Gott, bin ich als Christ und besonders auch als Neutestamentler nicht nur auf das Hören der jüdischen Bibel, sondern auch auf das Hören des jüdischen Zeugnisses verwiesen. Denn Israels Gott gibt es nicht ohne sein Volk Israel, ohne das jüdische Volk. In Jesaja 43,12 heißt es in Gottesrede an Israel: „Und ihr seid meine Zeugen, Spruch des Ewigen, und ich bin Gott.“ Rabbinische Auslegung nimmt das so auf: „Wenn ihr meine Zeugen seid, bin ich Gott; wenn ihr aber nicht meine Zeugen seid, bin ich gleichsam nicht Gott“ (Sifrej Dvarim § 346). Wir Christinnen und Christen machen gewiss – durch die Botschaft von Jesus vermittelt – unsere eigenen Glaubenserfahrungen. Wer aber Gott als Israels Gott ist, das zu beschreiben, ist Sache des jüdischen Zeugnisses – in der jüdischen Bibel und in der weitergehenden jüdischen Tradition. Will ich also festhalten, dass Gott, zu dem ich mit meinen Vorfahren durch Jesus in Beziehung gesetzt und gehalten bin, Israels Gott ist und bleibt – und das festzuhalten, bin ich durch meine kanonischen Grundlagen angehalten –, bleibe ich auf jüdisches Zeugnis angewiesen. Wenn ich also als Neutestamentler auf jüdisches Zeugnis höre, ist das nicht nur eine historisch-religionsgeschichtlich naheliegende Pragmatik, sondern es ist zutiefst theologisch bedingt.
4. Wie das Neue Testament hinzukam
Wenn es also in der auf Jesus als Messias bezogenen Gemeinschaft immer schon eine Bibel gab, nämlich die jüdische, wieso – könnte man fragen – hat man sich damit dann nicht zufrieden gegeben, sondern diese Bibel um das Neue Testament erweitert? Auch hier hat man nicht eines Tages einen Beschluss gefasst: So, jetzt reicht uns die bisherige Bibel nicht mehr; wir brauchen dazu noch etwas Neues. Ich sage es zunächst einmal einfach so: Es hat sich ergeben. Es hat sich ergeben aus der Lesepraxis der Gemeinden.
Was im heutigen Judentum Praxis ist, dass im Laufe eines Jahres Schabbat für Schabbat die ganze Tora gelesen wird und dazu jeweils ein Abschnitt aus den Propheten, die Haftara, beruht auf einer Tradition, die bis in die Antike zurückreicht, sicherlich mit Variationen in der Form. Im Neuen Testament wird diese Tradition etwa in Apg 13,15 bezeugt. Dort heißt es im Blick auf die Synagoge im pisidischen Antiochia an einem Schabbat: „Nach der Lesung aus Tora und Propheten …“ (vgl. weiter Lk 4,17; Apg 13,27; 15,21; 2Kor 3,15).
In den messiasgläubigen Gemeinden wurde Gott selbstverständlich dafür gepriesen, dass er Himmel und Erde geschaffen, dass er Israel aus Ägypten geführt hatte. Aber er wurde auch dafür gepriesen, dass er Jesus von den Toten auferweckt und zum Herrn gemacht hatte. Von daher galten Jesusworte als „Herrenworte“. Sie bekamen denselben Rang wie Schriftworte, weil es doch Gott selbst war, der durch Jesus gehandelt und gesprochen hatte. Und was sich dann nach und nach darauf bezogen an Schriftlichem einfand, wurde in den Gemeinden bei ihren Versammlungen vorgelesen. So wurden Texte der „Schrift“ und Texte dieser Art mit gleichem Gewicht in den Gemeindeversammlungen gelesen. So bezeugt es der Apologet Justin nach der Mitte des 2. Jahrhunderts.
Wahrscheinlich um diese Zeit wurden Schriften, die in den Gemeinden als Lesetexte in Gebrauch waren, zum „Neuen Testament“ zusammengestellt und mit der dann „Altes Testament“ genannten jüdischen Bibel verbunden. Das geschah wohl in Reaktion auf Markion, der die jüdische Bibel und den in ihr bezeugten Gott verwarf. Er schuf daher einen neuen Kanon, bestehend aus dem Lukasevangelium und zehn Paulusbriefen, nachdem er diese Schriften von angeblichen jüdischen Zusätzen „gereinigt“ hatte. Das dem gegenüber entstandene „Neue Testament“ hat sich durchgesetzt. Es konnte das, weil die im Neuen Testament versammelten einzelnen Schriften weithin in den Gemeinden schon als Lesetexte bekannt waren. Auch die Entstehung des Neuen Testaments unterstreicht seinen Zusammenhang mit dem Alten Testament als einen elementaren und unlöslichen.
5. Die Frage nach dem Verhältnis von Altem und Neuem Testament
Luthers bekannte Aussage, im Alten Testament gelte das, „was Christum treibet“, ist nicht nur eine Verengung, sondern führt auch zur Verzeichnung der jüdischen Bibel und des Judentums. Luther ignoriert das am Alten Testament, was er für spezifisch jüdisch hält, wertet das in ihm Gebotene negativ als „Gesetz“ ab, das die Juden zur Werkgerechtigkeit verführe, und nimmt positiv auf, was er als Verheißung in ihm erkennt, die auf Christus hinweise, ja ihn schon enthalte. Luther verabsolutiert diesen dritten Punkt und wendet sich von ihm her strikt dagegen, auch nur im Geringsten auf jüdische Auslegung zu hören. Auf dieser Linie Luthers liegen heutige Versuche, die „das Christusgeschehen“ zum Verstehensschlüssel des Alten Testaments machen oder die Einheit der Bibel vom „Christusgeschehen“ her bestimmt sehen. Sie wiederholen dabei zwar nicht Luthers antijüdische Ausfälle, müssen sich aber fragen lassen, wie sie damit umgehen, dass diese Position eine Eigenaussage der jüdischen Bibel und die Bedeutung jüdischer Auslegung implizit grundsätzlich in Frage stellt. Ich habe versucht darzulegen, warum es für Christinnen und Christen geboten ist, die Eigenaussage der jüdischen Bibel und jüdische Auslegung wahrzunehmen. Von daher ergibt es sich: Die Einheit der christlichen Bibel ist nicht von Jesus her, nicht in christologischer Perspektive zu suchen. Sie ist theologisch vorgegeben, da für die neutestamentlichen Autoren Gott, den sie als in Jesus wirkend bezeugen, kein anderer ist als der, den sie aus ihrer jüdischen Bibel kennen.
Das schließt es nicht aus, die Jesusgeschichte in der jüdischen Bibel wieder zu entdecken. Wie gezeigt, stellen die Evangelisten sie ja gerade von dorther dar, was für sie fundamental ist. Kanonische Texte haben ein Potenzial, das offen ist für eine Vielfalt von Auslegungen. Aber das für die Verhältnisbestimmung von Altem und Neuem Testament dominant gewordene Schema von Verheißung und Erfüllung wird dem neutestamentlichen Tatbestand nicht gerecht. Diese Zuordnung reduziert das Alte Testament auf eine Funktion für das Neue und lässt es in und mit diesem „aufgehoben“ sein. Dagegen sei auf zwei Punkte hingewiesen. Einmal ist hinter die Rede von der „Erfüllung“ ein kräftiges Fragezeichen zu setzen. Was an den großen Verheißungen der jüdischen Bibel ist denn tatsächlich „erfüllt“ worden? In der auf Jesus bezogenen Gemeinschaft, aus der die christliche Kirche hervorging, sind in der Geschichte, die weiterlief, als wäre nichts geschehen, immer nur fragmentarische Erfahrungen des Erhofften gemacht worden. „Erfüllt“ ist, dass zwar nicht die Völker der Welt, aber doch immerhin zahlreiche Menschen aus den Völkern der Welt zum Glauben an den in der Bibel bezeugten Gott Israels als den einen Gott gekommen sind. Damit finden sie sich zusammen mit Israel, mit dem Judentum, in einer Hoffnungsgeschichte vor und nicht in einer Erfüllungsgeschichte.
Sodann ist zu hinterfragen, ob die Übersetzung des in diesen Zusammenhängen gebrauchten griechischen Wortes mit „erfüllen“ die angemessenste ist. Die besonders im Matthäusevangelium öfters begegnende Formulierung: „damit bzw. sodass erfüllt würde, was geschrieben steht“ hat eine genaue sachliche Entsprechung in der bei den Rabbinen mehr als 200-mal begegnenden Wendung: „um aufzurichten/zustande zu bringen/auszuführen, was gesagt worden ist“. Bei dem Wort „erfüllen“ ist die Vorstellung von einem Leerraum da, der gefüllt werden muss; und wenn er voll ist, ist die Sache erledigt. Aber das in den biblischen Texten Gesagte ist nicht „erledigt“. Und auch das mit „erfüllen“ übersetzte griechische Wort kann sich von dieser Vorstellung lösen und die Bedeutung „ausführen“, „verwirklichen“ haben. Weder die rabbinischen noch die neutestamentlichen Stellen, die ein erzähltes Geschehen durch die angeführte Wendung mit der Schrift verbinden, sind im Schema von Verheißung und Erfüllung geschrieben. Ihre Autoren entdecken vielmehr Momente dessen, worüber sie jeweils schreiben, in der Schrift. Indem sie das kenntlich machen, bringen sie das Mitsein Gottes im beschriebenen Geschehen und sein Wirken darin zum Ausdruck.
6. Versuch einer kurzen Antwort auf die Titelfrage
Lesen Juden und Christen dieselbe Bibel? Ich verbinde diese Frage mit einer Aussage Gadamers: „Wir lesen niemals dasselbe Buch. Weil wir uns als Lesende verändern. Weil wir, wenn wir ein Buch ein zweites Mal lesen, uns in einer anderen Situation befinden als beim ersten Mal.“ Ich habe in meinem Studium und auch noch Jahre danach die Bibel und besonders das Alte Testament anders gelesen als heute. Ich lese heute anders, weil ich mich verändert habe. Ich habe mich verändert – jetzt nehme ich eine schöne Formulierung Jürgen Ebachs auf – im Hören „auf das, was Israel gesagt ist und was in Israel gesagt wird“. So antworte ich: Ob wir im Blick auf die identischen Teile von jüdischer Bibel und Altem Testament dieselbe Bibel lesen, hängt davon ab, wie wir sie lesen. Genauer: ob wir Christinnen und Christen es lernen, unsere Bibel im Hören auf jüdisches Zeugnis und also im Bewusstsein der Gegenwart Israels zu lesen.
Prof. Dr. Klaus Wengst
Das Christentum gilt lange Zeit als Tochter des Judentums. In christlichem Denken, in Theologie und auch in Machtpolitik nabelt es sich in der Antike von seiner Mutter ab und entwickelte zum Teil einen Hass auf sie, der bis zur Vernichtung führte. Erst nach der Shoa, dem tragischen Höhepunkt jener Israel-Vergessenheit, besinnen sich christliche Theologie und Kirchen auf ihre Wurzeln und so auf Gemeinsamkeiten, geteilte Ziele in der Gegenwart und die Notwendigkeit einer positiven Besinnung auf Jüd*innen.
In der Forschung werden Jesus und auch Paulus als Juden wiederentdeckt: Sie waren weder Christen, noch ›erfanden‹ sie das Christentum. Die urchristliche Bewegung wird ebenso wie die Evangelien wieder als jüdisch verstanden. Forschungen wie jene von Daniel Boyarin oder Peter Schäfer zeigen nicht nur eine größere jüdische Kontinuität der als urchristlich verstandenen Jesus-Bewegung, sondern sie weisen auch darauf hin, dass das Judentum und das sich entwickelnde Christentum eher als Geschwister zu verstehen sind: Das biblische Judentum brachte damit das rabbinische Judentum einerseits und die christliche Bewegung andererseits hervor. Nicht der Juden Jesus von Nazareth und auch nicht der Jude Paulus gründeten ›das Christentum‹, sondern in der Forschung wird davon ausgegangen – und das ist der entscheidende Paradigmenwechsel –, dass erst im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von einer Trennung dessen gesprochen werden kann, was wir als Judentum und Christentum kennen. Und die Geschichte ist nicht von einseitigen, sondern von gegenseitigen Beeinflussungen geprägt (wie z.B. in Theologie und auch Liturgie) – weit über die Antike hinaus.
Das Christentum entwickelt dann geradezu frenetischen Hass in Erbstreitigkeiten mit ihrer Schwester, dem Judentum: Sie, das Christentum, sie das wahre Israel, ihr gelten die biblischen Verheißungen, und seine Schwester sei auf dem Irrweg.
Biologische Bilder und Metaphern können problematisch sein, und sie können überstrapaziert werden. Aber deutlich wird: Die Ursprünge des Christentums sind jüdisch; es gibt nicht nur keine nicht-jüdischen Ursprünge des Christentums, sondern die Anfänge des Christentums selbst sind eigentlich nicht einmal christlich.
Auch deswegen führt diese gemeinsame Geschichte zu Asymmetrien – nicht nur in der Historie der christlichen Hegemonialtheologie, sondern auch im gegenseitigen Geschwisterverhältnis: Das Christentum ist von seinen Grundlagen und von seiner Basis her radikal abhängig vom Judentum. Es kann nicht ohne jüdische Traditionen gedacht werden. Und asymmetrisch bleibt auch das Gespräch von Jüd*innen und Christ*innen in der Gegenwart: Die gleichberechtige Normalität, die durch Jüd*innen bsp. im 19. Jahrhundert in der Wissenschaft des Judentums von Christen eingefordert wurde, blieb ein Schrei ins Leere und damit versagt. Der Massenmord an den europäischen Jüd*innen – befeuert auch und gerade durch christlichen Judenhass – führte fast nur gänzlichen Vernichtung.
In den dritten Generationen nach der Shoa hat sich Vieles gewandelt in der christlichen Familie in Bezug auf ihre jüdischen Geschwister. Das Christentum ist kein Einzelkind: Diese Erkenntnis bahnt sich langsam und mühsam ihren Weg der Erkenntnis. Denn Notwendiger denn je sind christliche Theologien, die jüdische Traditionen und jüdische Kritik ernst- und fruchtbar aufnehmen, sowie ein gemeinsames Wirken in der Gesellschaft zusammen mit Jüd*innen – nicht gegen sie, und auch nicht miteinander unter Verweis auf ein als solches nie existierendes sog. ›jüdisch-christliches Abendland‹ gegen Muslim*innen.
Es ist noch viel zu revidieren und aufzuarbeiten in der christlichen Familiengeschichte. Sie kann nicht neu, aber anders geschrieben werden.
Jonas Leipziger