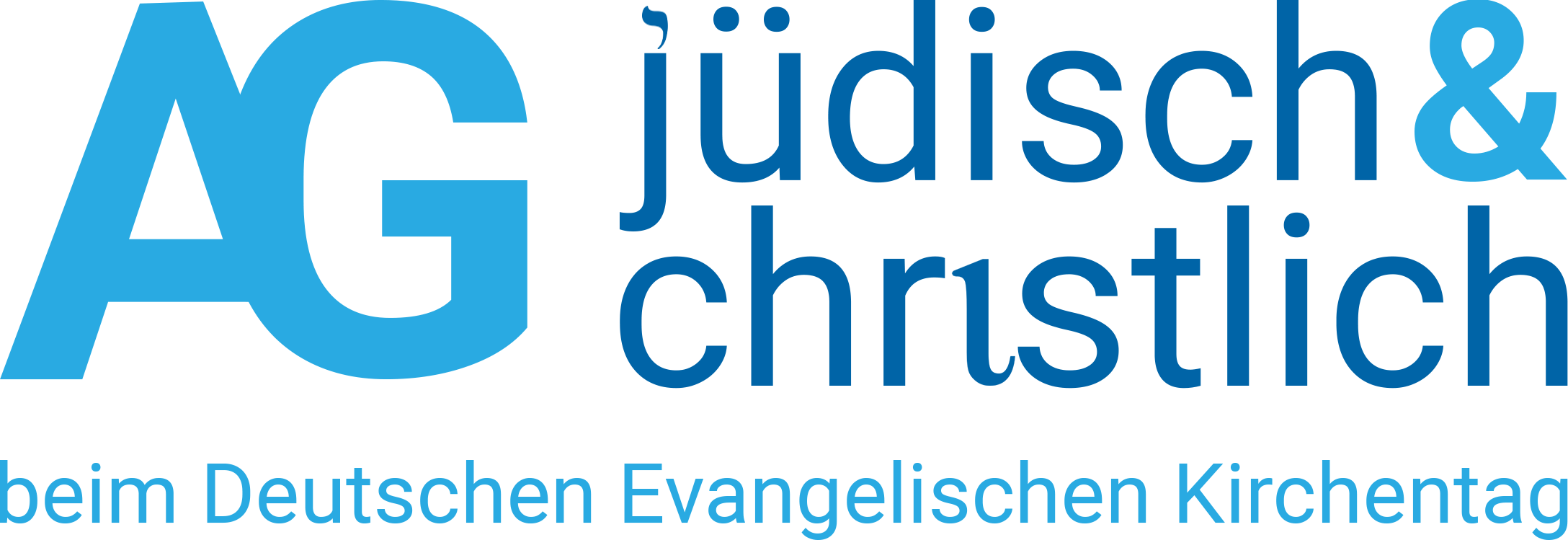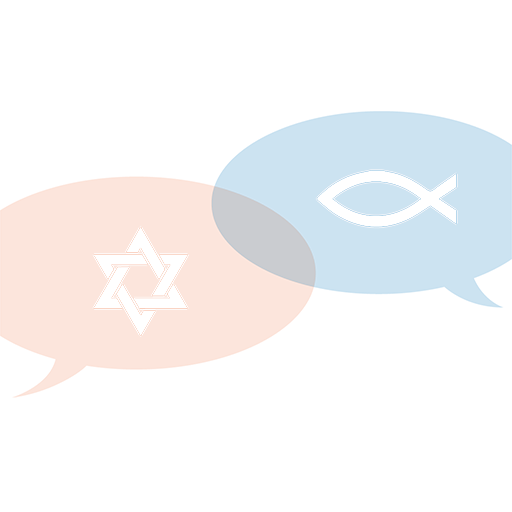
Neue Gesprächsräume gestalten
Ein persönlicher Blick auf den Kirchentag in Berlin
Frederek Musall
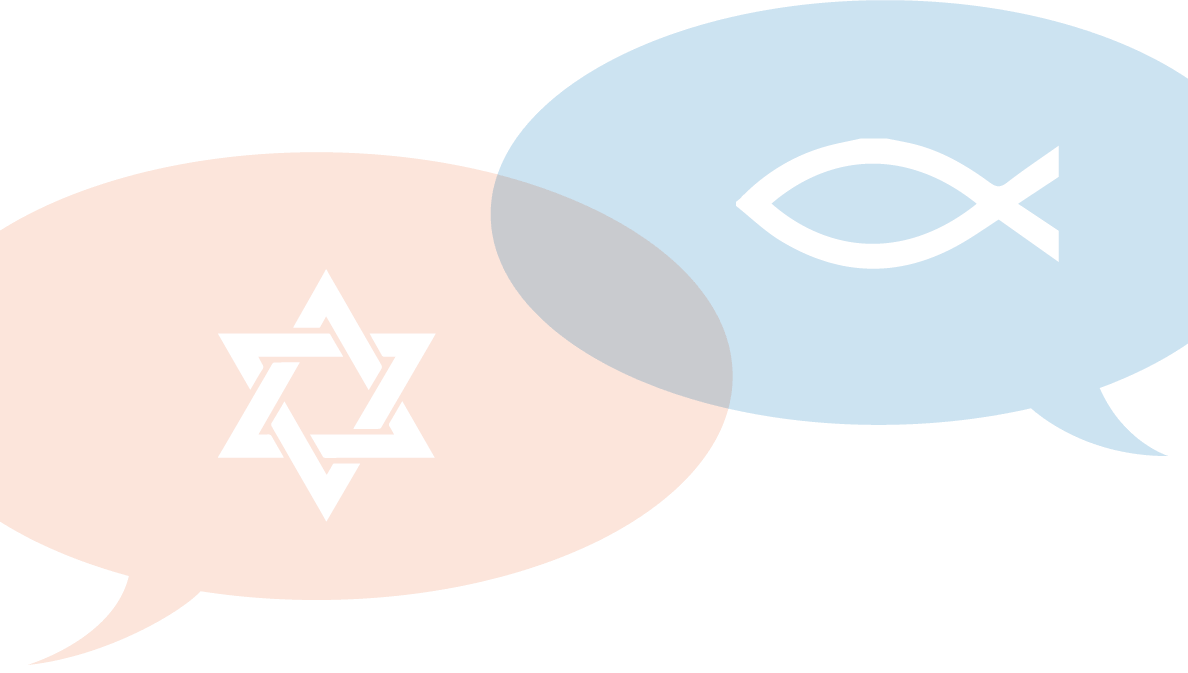
Ich muss gestehen, dass ich froh war, als er endlich vorbei war, der Berliner Kirchentag 2017. Fünf vollgepackte Tage ließen mir nur wenig Raum für Rückzug, zur Atempause, zum Nachdenken – geschweige denn Schlaf. Meine Kirchentagsmüdigkeit resultierte wohlmöglich auch daraus, dass ich unter ganz anderen Voraussetzungen angereist war: Vielen Christinnen und Christen bietet der Kirchentag zahlreiche Angebote, um spirituell aufzutanken; er eröffnet unterschiedliche Begegnungsebenen und Gesprächsräume, um sich auszutauschen und das eigene christliche Selbstverständnis artikulieren zu können.
Allerdings war ich weder auf der Suche nach dem einen noch nach dem anderen. Und vielleicht fühlte ich mich deshalb auch oft fremd und befremdet im orangefarbenen Taumel, nicht zuletzt weil meine eigene religiöse Musikalität dann doch so ziemlich auf das Judentum in all seiner Vielfalt beschränkt ist. Aber wenn alles wirkliche Leben Begegnung ist, wie Martin Buber schreibt, gilt es dann nicht gerade aus der Behaglichkeit der eigenen Komfortzone herauszutreten und die Begegnung bewusst zu suchen?
Begegnung ist schließlich nicht der Schritt weg von mir, sondern der auf den Anderen zu.
Was mich motiviert an diesem Aufeinander-Zugehen und der gemeinsamen Auseinandersetzung ist ein Nachdenken darüber, wie ein jüdisch-christliches Gespräch auf Augenhöhe stattfinden und gelingen kann; einer Augenhöhe, die durch mehr getragen wird als durch geistige Trittleitern oder Kniebeugen. Denn es geht nicht nur um das theologische Verhältnis von Judentum und Christentum, sondern eben auch darum, wie wir uns angesichts bestehender und nur schwer zu überwindender Asymmetrien im gesamtgesellschaftlichen Kontext begegnen können und wollen. Das ist in der Praxis jedoch einfacher gesagt als getan, gerade wenn unterschiedliche Erwartungshorizonte aufeinandertreffen.
Der Versuch, sich dem ständig als Jude oder Jüdin – als der oder die Andere – markiert zu werden zu entziehen, ging in der gemeinsamen Bibelarbeit mit meinem Heidelberger Kollegen Jonas Leipziger jedenfalls gründlich schief, da ein Großteil des Publikums die entsprechenden Markierungen erwartete und gar einforderte. Aber werde ich nicht dadurch auf mein Jüdischsein reduziert, in meiner Identität essenzialisiert? Kann und soll es wirklich darum gehen, vorgegebene Rolle zu repräsentieren und zu vertreten, anstatt sich als Personen mit komplexen Bezugssystemen in einem gemeinsamen Reflexionsprozess auszutauschen?
Ich glaube, mir ist erst im Erleben des Kirchentages bewusst geworden, wie sehr das jüdisch-christliche Gespräch geprägt ist von unterschiedlichen Begehren, Wünschen und Erwartungshaltungen, die nicht immer einfach aufzufangen und aufzugreifen sind. Umso wichtiger erscheint es mir, in der Bewusstmachung dieser Momente neue Gesprächsräume für gemeinsame Aushandlungsprozesse zu gestalten. Vor allem da sich bezüglich der jüdischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hierzulande etwas Grundlegendes verändert hat.
Es existiert nun eine jüdische Gemeinschaft in Deutschland, die – wenn auch nicht immer unter einfachen Bedingungen – ihr Selbstverständnis bewusst und offen lebt, und die sich plural und polyphon artikuliert. Aber eben auf eine andere Art und Weise als in den jüdischen Zentren in Nordamerika und Israel. Das kann durchaus irritieren: Bei manchen Christinnen und Christen, denen ich auf dem Kirchentag begegnete, spürte ich die Sehnsucht nach einer vermeintlichen jüdischen Authentizität, die jedoch aufgrund ihrer persönlichen Befindlichkeiten, Standpunkte und Projektionen ebenso unreflektiert wie schnell in stereotype Zuschreibungen abdriftete.
Aber Begegnung sollte niemals von Gewissheiten über sich und den oder die Andere bestimmt sein. Vielmehr erfordert sie den Mut, die eigenen Ungewissheiten auszuhalten.
Ziel der Begegnung sollte sein, dass ein jeder oder jede für sich etwas in der Begegnung entdecken kann, was er oder sie mit dem Eigenen in Verbindung zu bringen vermag. Das heißt: wenn wir a.) in Auseinandersetzung mit unseren eigenen Grundlagen, aber b.) verbunden durch die Auseinandersetzung mit denen der anderen c.) die eigene Position deutlich machen können, was es d.) dem oder der anderen ermöglicht etwas für sein oder ihr Verstehen – über uns, aber auch über sich selbst – zu gewinnen. Deshalb sollte es im jüdisch-christlichen Gespräch nicht primär um Hauptwörter gehen, das heißt um Judentum oder Christentum, sondern um die Mannigfaltigkeit der daran teilnehmenden Personen.
Das jüdisch-christliche Gespräch ist dynamisch, es verändert sich ständig, und entsprechend müssen auch die Fragen nach dem, was uns verbindet und was uns trennt, was uns gemeinsam angeht oder aber was wir unabhängig voneinander verhandeln müssen, immer neu gestellt werden. Aber wir müssen auch verstehen, dass bestimmte Diskurse, die wir führen, zwar oftmals verbunden, aber nicht immer identisch für alle Beteiligten sind: Beispielsweise ist Antisemitismus zu definieren nicht das Gleiche, wie ihn zu erfahren. Auch ist Jüdischsein für viele Jüdinnen und Juden nicht gleichbedeutend mit einer religiösen Selbstverortung.
Was ich aus Berlin mitgenommen habe, sind zahlreiche Anregungen, mit neuen Formaten und Themen zu experimentieren, die neben der Vielschichtigkeit jüdisch-christlicher Gesprächsräume eben auch die jüdische Vielfalt und Lebenswirklichkeit in Deutschland zum Ausdruck bringen und zu Wort kommen lassen.
Das heißt, es muss nicht immer um theologische Fragestellungen und Zusammenhänge gehen. Was uns verbindet, ist auch die Suche nach dem, wer wir sind in der modernen Lebenswelt; nach einer Identität, die keine Angst vor Komplexität haben und sich nicht auf Identitäres reduzieren lassen muss; die das Gegenüber in seiner oder ihrer Andersartigkeit akzeptieren kann, darin auch zugleich Trennendes, Ungewisses und Ungleichzeitiges auszuhalten vermag. Nochmals: Wenn alles wirkliche Leben Begegnung ist, dann sollten wir ständig daran arbeiten, neue Gesprächsräume zu denken und zu gestalten, um uns in der Begegnung entfalten zu können!
Dieser Beitrag erschien zuerst im Magazin Der Kirchentag (1) 2018, 20–21.