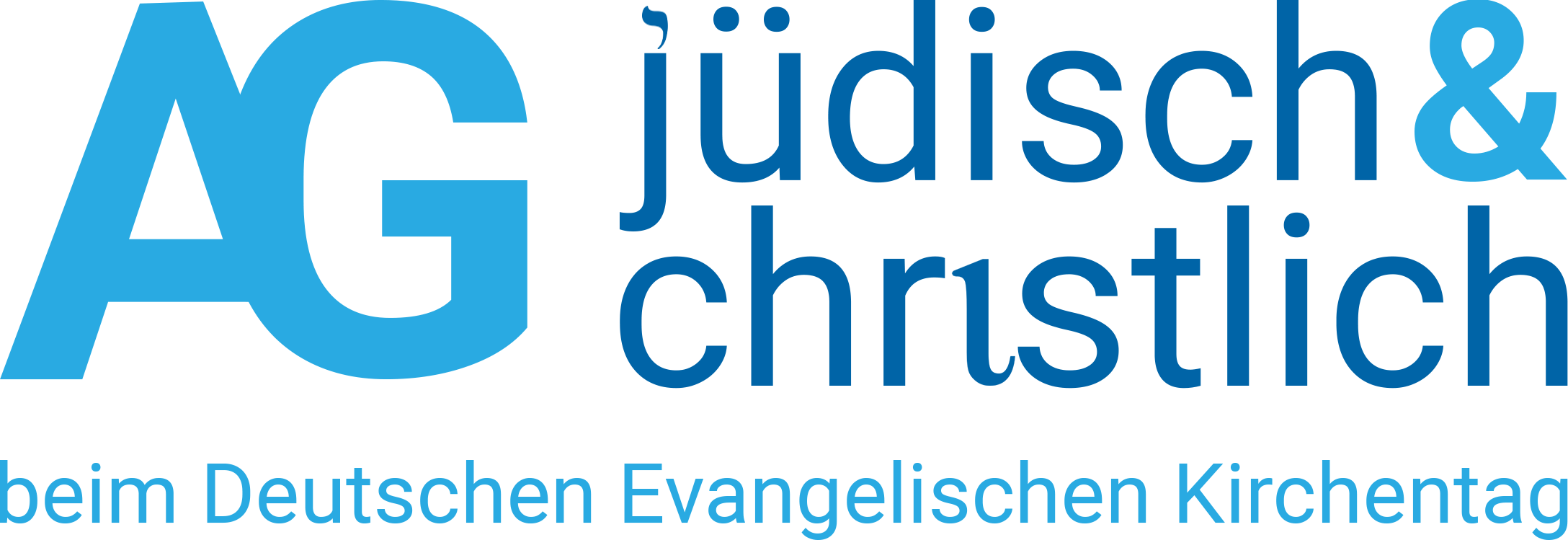4. „O chavruta o mituta“
Geh und lerne: Ich beschreibe ausgehend vom alten Hillel schließlich noch einen vierten Lernschritt, dazu brauche ich Beide: Hillel und Schammai. Es geht um die Einsicht, dass du im halachischen Diskurs nur in Partnerschaft weiter kommst – „o chavruta o mituta“ – entweder Lerngemeinschaft oder Tod (ta‘anit 23b). Es geht um Weggemeinschaft unter Ungleichen. Es geht unterwegs um versöhnte Verschiedenheit. Auch zwischen Juden und Christen – diesen Schritt möchte ich weitergehen.
Von den beiden Häusern Hillel und Schammai heißt es: Sie stritten darum, welchem von beiden zu folgen sei – Wer hat die Halacha auf seiner Seite? Und dann fällt im Talmud (eruvin 13b) der atemberaubende Satz: „Elu ve-elu divre Elohim chajim“ – „Diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes.“ Die Wahrheit – liegt nicht in der Mitte, sondern: Die Wahrheit ist plural, wie das Leben plural ist. „Elu ve-elu divre-Elohim chajim“ – Solche Sätze brauchen wir heute so dringend – gesprochen nicht aus einer Beliebigkeit heraus, sondern aus der Einsicht, dass uns die Wahrheit immer schon voraus ist. Die Ethik indes – die Lebenspraxis – sucht und braucht die Entscheidung, ringt um Halacha: Ich muss entscheiden zwischen Krieg und Frieden, zwischen Versklavung und Befreiung, zwischen Abschieben und Beherbergen.
Und darum fährt der Talmud fort: Beide reden sie Worte des lebendigen Gottes, aber: „Die Halacha, d.h. die religiös verbindliche Praxis, entspricht der Lehre des Hauses Hillel“. Warum? Weil Ihr Hilleliten auch die Worte des Hauses Schammai weiter tradiert, sogar an die erste Stelle setzt, als Mahnung gegen alle Einheitsideologien, gegen alle Absolutismen, gegen alle Exklusivismen eines Wahrheitsfetischismus, der uns die Luft zum Atmen nimmt.
Die entscheidenden Lernschritte werden wir nur in Chavruta tun können, im partnerschaftlichen Lernen unter Ungleichen in versöhnter Verschiedenheit. Auch unter Juden und Christen. Geht und zieht lernend die Konsequenzen!
Die KLAK, in deren Auftrag ich hier stehe, tut das schon seit 40 Jahren. Hat es erst jüngst verdichtet in den 3 hebräischen Worten des Logos: harninu gojim amo: „Preist, ihr Völker, sein Volk!“ – oder: „Gebt, ihr Gojim, seinem Volk Anlass zum Jubel!“ „Lebt so, dass der oder die Andere Grund zum Jubel hat!“ Das ist die KLAKsche Wendung der Goldenen Regel. Geht und lernt – ihr Juden und Christen.
Das wäre ein Stückchen Himmel auf Erden, wenn unterwegs auf diesem gemeinsamen Lernweg einer zum anderen sagen könnte: „Ja, du hast mich unter die Flügel der schechina gebracht.“
Zuerst erschienen auf den Seiten der KLAK.